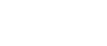Ann-Kathrin Schneider: Die EU zwischen Niedergang und Neugründung: Wege aus der Polykrise
25. Würzburger Europarechtstage am 19./20. 7. 2019
Die umfassende Beleuchtung der politisch brisanten und rechtlich anspruchsvollen multiplen Krise, mit der die Europäische Union seit Jahren kämpft, war Gegenstand der 25. Würzburger Europarechtstage am 19./20. 7. 2019. Durch offenen Widerstand gegen geltendes Unionsrecht sowie die innerstaatliche Unterminierung der Werte des Art. 2 EUV seitens einzelner Mitgliedstaaten ist eine zunehmende Spaltung der Gemeinschaft wahrzunehmen. Daneben hat der Migrationsdruck der vergangenen Jahre die fortwirkenden Schwächen der EU-Asylvorschriften offenbart. Der drohende Brexit wirft zahlreiche ungeklärte Fragen über die zukünftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU auf. Inzwischen wurde die Austrittsfrist ein weiteres Mal bis zum 31. 1. 2020 verlängert und das britische Parlament hat sich nach langem Ringen auf Neuwahlen am 12. 12. 2019 geeinigt. Auch die nachwirkende Banken- und Finanzkrise stellt eine große Herausforderung dar. Der Einladung von Prof. Dr. Markus Ludwigs und Prof. Dr. Stefanie Schmahl folgten neben den Vortragenden rund 180 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis (darunter auch zahlreiche Studierende), um Wege aus der gegenwärtigen Polykrise aufzuzeigen.
I. Einleitung
Die Jubiläumsveranstaltung wurde mit einem Grußwort des Präsidenten der Julius-Maximilians-Universität Prof. Dr. Dr. hc. Alfred Forchel in der Würzburger Neubaukirche eröffnet. Das hochaktuelle Tagungsthema lade zur Erinnerung an die Geschichte des historisch bedeutsamen Tagungsorts ein, der bei einem verheerenden Bombenangriff im Jahre 1945 fast vollständig zerstört wurde. Der Wiederaufbau der Neubaukirche stellte ein Gemeinschaftsprojekt von Universität und Stadt sowie der Bevölkerung dar. Vergleichbar hiermit bilde auch die Europäische Union ein Gemeinschaftsprojekt. Dabei bestehe durchaus dringender Reformbedarf, was Forchel mit der Hoffnung verband, dass die Tagung einen Beitrag zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen leisten könne.
Der Dekan der Juristischen Fakultät Prof. Dr. Olaf Sosnitza betonte die Bedeutung der Europarechtstage als Ausweis der Internationalität und Sichtbarkeit der Fakultät. In der Vergangenheit hätten die Europarechtstage zunächst Grundsatzfragen betrachtet und sich später spezifischen Fachthemen gewidmet. Die Jubiläumsveranstaltung könne mit Erörterung der multiplen Krise der EU eine Rückkehr zur Beleuchtung von Grundsatzfragen darstellen und so eine dritte thematische Phase einleiten. Das diesjährige Tagungsthema behandle drängende Probleme, zu deren Lösung womöglich differenzierte Wege eingeschlagen werden müssten.
Schmahl skizzierte sodann die im Fokus stehenden aktuellen Probleme der Wertegemeinschaft. Insbesondere Polen und Ungarn leisteten in verschiedenen Bereichen offenen Widerstand gegen geltendes EU-Recht, was zu einer Destabilisierung der Rechtsgemeinschaft führe. Darüber hinaus werde die Werteklausel des Art. 2 EUV dadurch unterminiert, dass beide Staaten kontinuierlich die Unabhängigkeit des innerstaatlichen Justizsystems schmälerten. Im Themenblock Migration stehe aktuell eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems im Zentrum der Aufmerksamkeit. Deren Notwendigkeit werde etwa durch die systematische Nichtanwendung der obligatorischen Vorschriften zur Überstellung und Umverteilung von Asylbewerbern sowie durch die verstärkte Wahrnehmung von Rettungsmaßnahmen auf See mittels Nichtregierungsorganisationen sichtbar. Aktuell werde ein Paket an neuen Legislativvorschlägen der Europäischen Kommission mit dem Ziel einer Rechtsvereinheitlichung diskutiert.
Ludwigs beleuchtete kurz den Stand des Austrittsverfahrens des Vereinigten Königreichs, dessen Ausgang nach wie vor ungewiss sei. Selbst ein zweites Referendum sowie die einseitige Rücknahme des Austrittsabkommens seien im Lichte der Rs. C-684/16 (Wightman) unionsrechtlich möglich und politisch nicht mehr ausgeschlossen. Die Reformen infolge der Finanz-, Banken- und Staatsschuldenkrise würden neue Fragen im Hinblick auf den Vorrang des Unionsrechts und seine Grenzen aufwerfen. Aktuelle Brisanz habe im Rahmen der Judikatur zu den Anleihekaufprogrammen der EZB insbesondere eine vom EuGH (Rs. C-493/17) für unzulässig erklärte Vorlagefrage des BVerfG, was das Kooperationsverhältnis erneut belasten könne. Auch im Rahmen der Eurozonenreform seien bereits Konturen in Bezug auf die geplante Neuausrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erkennbar, sodass erste Bewertungen vorgenommen werden könnten.
II. Wertegemeinschaft
Den Themenblock I eröffnete Prof. Dr. FrankHoffmeister (Europäische Kommission) mit dem Referat „Die Werteunion: Anspruch und Wirklichkeit“. Die Werteunion befinde sich gegenwärtig in einem Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch werde durch die primärrechtlichen Grundlagen abgebildet. Von besonderer Relevanz sei hier der Wertekanon des Art. 2 EUV, bei dessen Auslegung eine rechtsvergleichende Perspektive geboten erscheine. Die Beitrittskonditionalität des Art. 49 EUV setze neben den geschriebenen Kriterien auch das ungeschriebene Prinzip gutnachbarlicher Beziehungen voraus, was die Blockade des EU-Beitritts Kroatiens durch Slowenien belege. Während Art. 21 EUV die Werteprojektion nach außen sicherstelle, erfordere Art. 7 EUV innerhalb der EU ein gewisses Maß an Homogenität. Die Empfehlungs- und Sanktionsbefugnis des Art. 7 EUV habe hohe materiell-rechtliche Hürden. Als „nukleare Option“ solle der als ultima ratio mögliche Entzug von Stimmrechten primär Abschreckungswirkung entfalten. Daneben blieben auch Vertragsverletzungsverfahren gem. Art. 258 AEUV weiterhin statthaft. In der Erweiterungspraxis der Union müsse zunächst positiv festgestellt werden, dass der Wertekanon von potentiellen Beitrittsstaaten regelmäßig beachtet werde. Außenpolitisch bestehe beispielsweise die Möglichkeit, die Beachtung der Werte nach Art. 2 EUV in Handelsverträgen festzuschreiben. Auch die „Rule of Law Checklist“ der Venedig-Kommission könne herangezogen werden. Anhand der Fälle Österreich, Ungarn und Polen schilderte Hoffmeister sodann die innenpolitische Wirklichkeit und erläuterte das Konzept zum weiteren Vorgehen der Kommission (KOM (2019) 343 final vom 17. 7. 2019), um die Rechtsstaatlichkeit in der Union zu stärken. Erreichen könne man die Ziele u.a. mit dem Aufbau von Wissen und der Schaffung einer gemeinsamen Kultur der Rechtsstaatlichkeit sowie der verstärkten Zusammenarbeit mit dem Europarat. Künftig solle ein Jahresbericht über die rechtsstaatliche Situation in allen Mitgliedstaaten eine bessere Beobachtung ermöglichen und innenpolitische Schwierigkeiten infolge bisher nur partiell durchgeführter Untersuchungen überwinden. Dem hohen normativen Anspruch der Werteunion könne nur durch einen kollektiven Einsatz der Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden, denn „keiner sei perfekt“, so Hoffmeister in Anlehnung an eine frühere Äußerung der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Im Anschluss sprach Prof. Dr. PálSonnevend (Eötvös-Lórand-Universität Budapest) zum Thema „Rechtsstaat und Demokratie: Wie lässt sich ein europäisches Minimum bestimmen? Erkenntnisse aus den Verfahren gegen Ungarn und Polen“. Die Entwicklung des Rechtsstaatsbegriffes habe ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Hier kam dem Rechtsstaat insbesondere die Aufgabe zu, Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat zu schützen. Während der Begriff früher eher formal ausgelegt wurde, wandelte er sich im Laufe der Zeit. Heute überwiege ein materielles Rechtsstaatsverständnis. Verstehe man den Terminus hingegen populistisch, ermögliche der Rechtsstaat die Herrschaft von „Law and Order“ und diene lediglich als Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Mehrheit. Zahlreiche Maßnahmen Ungarns und Polens zur kontinuierlichen Schmälerung des innerstaatlichen Justizsystems zeigten die Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Lösung. Besonders im Fokus stünden Beschränkungen der Unabhängigkeit der Verfassungs- und der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie die fortschreitende Einschränkung der Pressefreiheit. Beispiele seien die Nichtveröffentlichung von Entscheidungen des Verfassungsgerichts sowie die Herabsetzung des Ruhestandsalters für Richter am Obersten Gericht in Polen und die in Ungarn erfolgte Überführung fast aller privaten – insgesamt ca. 450 – Medien in ein einziges regierungsnahes Unternehmen. Die Vorgänge machten auf Strukturprobleme aufmerksam, denn die „Migration von Verfassungsideen“ sei nicht auf die Prinzipien der liberalen Demokratie begrenzt. Um etwaigen Gefahren vorzubeugen, müsse der Rechtsstaat die wesentliche Grundlage und Grenze bilden. Ein Warnsignal sei die Aussetzung der Vollstreckung eines durch ein polnisches Gericht erlassenen Europäischen Haftbefehls durch den irischen High Court, dessen Rechtmäßigkeit der EuGH in der Rs. C-216/18 PPU (LM) bestätigte. Sonnevend sieht die Schwierigkeiten gerade in der Definition eines Minimums an Rechtsstaat und Demokratie, wobei Art. 7 EUV zumindest einen Anhaltspunkt dafür gebe, dass beide Prinzipien nicht isoliert nebeneinander stünden, sondern sich notwendig ergänzten. Demokratische Legitimation setze gerade ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit voraus. Zum Kernbereich der Prinzipien gehörten u.a. das Wahlrecht, die Meinungs- und Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Gerichte sowie die unparteiliche und wirksame Strafverfolgung. Der Einwand, dass die EU unter einem demokratischen Defizit leide, greife im Ergebnis nicht durch, da ein Legitimationsstrang auch über die nationalen Parlamente verlaufe. Einbußen im Kernbereich des rechtsstaatlichen Minimums in den einzelnen Mitgliedstaaten wirkten sich gesamteuropäisch aus, gerade deshalb sei dessen Einhaltung besonders wichtig.
III. Migration
Im zweiten Themenkomplex erörterte Prof. Dr. FrankSchorkopf (Universität Göttingen) die Zukunft des Dublin-Rechts in seinem Vortrag „Das Dublin-Recht in der EU-Gesetzgebung – der institutionelle Rahmen für europäisches Migrationsrecht“. Die historische Entwicklung des Dublin-Regimes als Teilmenge des Migrationsrechts darstellend, verdeutlichte Schorkopf zunächst den Zusammenhang mit den Schengen-Abkommen. Um konkurrierende Asylzuständigkeiten zu vermeiden, traf man die Grundentscheidung der Zuständigkeit des Erstaufnahmestaates, welche bis heute nicht revidiert wurde. Die großen Fluchtbewegungen im Jahre 2015 indizierten jedoch die Dysfunktionalität des Systems deutlich. Das Dublin-Recht sei als „Schönwetterrecht“ auf derartige Herausforderungen nicht eingestellt. Die Anwendungs- und Strukturprobleme der Dublin III-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 604/2013) zeigten sich vor allem bei der Registrierung von Geflüchteten, dem Selbsteintritt der Mitgliedstaaten nach Art. 17 Dublin III-VO, der Sekundärmigration und der Rücküberstellung in die Herkunftsstaaten. Insbesondere die an den Außengrenzen der EU gelegenen Mitgliedstaaten könnten bzw. wollten den Kurs des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems nicht mittragen. Die Nichtregistrierung der Geflüchteten, die sog. Politik des Durchwinkens, verstärke die problematische Sekundärmigration. Das Selbsteintrittsrecht der Mitgliedstaaten sei zwar erkennbar nur auf Einzelfälle ausgelegt, jedoch habe der EuGH in der Rs. C-646/16 (Jafari) entschieden, dass auch massenhafte Selbsteintritte zulässig seien. Hinzu komme, dass die vertraglich vorgesehenen Rücküberstellungen – u.a. aufgrund von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Identitätsfeststellungen oder Problemen mit der Rechtstaatlichkeit im Ersteinreisestaat – nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel seien. Die Mitgliedstaaten duldeten derzeit die dargestellten Anwendungs- und Strukturprobleme mit der Folge, dass die politische Spaltung der Europäischen Union voranschreite. Die Kommission habe 2016 verschiedene Legislativvorschläge unterbreitet, wozu auch die Reform der Dublin III-Verordnung gehöre. Ziel dieser Novellierung sei ein sog. Fairness-Mechanismus, d.h. die Einführung eines verbindlichen Verteilungsschlüssels, abhängig von der Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten. Die Reform finde jedoch gegenwärtig keine einhellige Zustimmung im Europäischen Rat. Kritikwürdig sei, dass es bei der dysfunktionalen Grundentscheidung der Zuständigkeit des Erstaufnahmestaates bleibe. Vorzugswürdig erscheine es demgegenüber, den Fokus auf die Verringerung bestehender Anreize für Sekundärmigration zu legen. Eine Lösung könne darin bestehen, „Dublin“ und „Schengen“ zusammenzudenken und so den Weg zurück zur ursprünglichen Intergouvernementalität des Dublin-Rechts einzuschlagen.
Daran anschließend wagte Prof. Dr. MartinNettesheim (Universität Tübingen) in seinem Vortrag „Reform des Asylrechts: Humanität, Effizienz, Gerechtigkeit im Europäischen Verbund“ einen Blick jenseits von Dublin. Zwar könne man die Probleme des gegenwärtigen Systems als Krise der Rechtsanwendung oder als Krise der Solidarität bezeichnen, die Strukturprobleme lägen jedoch tiefer. Die Zuständigkeiten würden dysfunktional zugewiesen, sodass es sich im Kern um eine Krise der Aufgabenverteilung handele. Der Status quo veranschauliche, dass neben mangelnder Solidarität die Schwierigkeit darin bestehe, eine normative Lösung mit Interessensausgleich zu finden. Die aktuellen Vorschläge der Kommission, die u.a. von einer Erneuerung der sog. Eurodac-Verordnung (VO (EU) Nr. 603/2013) über die Substitution der Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU bis hin zur Reformierung der Dublin III-VO reichten, deuteten auf die Fortschreibung der Dysfunktionalitäten hin. Fortschritte seien nicht ersichtlich. Jenseits von Dublin müsse man deshalb im Rahmen der Raumverwaltung – wie zuvor bereits Schorkopf vorgeschlagen habe – „Dublin“ und „Schengen“ zusammendenken. Zudem erfordere die Feststellung der Schutzbedürftigkeit im Rahmen des Registrierungsverfahrens eine Supranationalisierung, um einheitliche Standards zu gewährleisten. Vorbild könne hier das niederländische Modell sein, das für die Zwecke der Union lediglich durch eine mit operativen Befugnissen ausgestattete Asylagentur zu ergänzen sei. Um der Aufnahme-, Schutz- und Integrationsverantwortung gerecht zu werden, ließen sich zwei konträre Lösungsansätze diskutieren: Auf der einen Seite stehe die Schaffung von Verteilungsgleichheit mittels Zufallsprinzips, auf der anderen die einseitige Wahlfreiheit der Asylsuchenden. Eine Verteilung mittels Zufallsprinzips sei weder fair noch angemessen. Das freie Wahlrecht könne Sekundärmigration verhindern, jedoch verkenne dieser Ansatz die Interessen der Aufnahmestaaten. Zudem sei nicht jeder Aufnahmestaat für die Geflüchteten gleich attraktiv. Die Lösung könne in einer Verhandlung unter Gegenüberstellung der Interessen des schutzsuchenden Menschen und denen des Aufnahmestaates bestehen, wobei die konkrete Ausgestaltung eines solchen Verfahrens noch der Erörterung bedürfe. Auf dem Weg hin zu einem fairen Lastenausgleich unter Berücksichtigung der Nachteile für die an den Außengrenzen der Union gelegenen Staaten könne kurzfristig eine Koalition der (Aufnahme-)Willigen gebildet werden.
IV. Brexit
Am zweiten Veranstaltungstag widmete sich zunächst Prof. Dr. RudolfStreinz (Ludwig-Maximilians-Universität München) dem Thema „Das Brexit-Referendum: Hintergründe, Streitthemen, Reversibilität“. Einleitend rief er dem Auditorium die Worte TheresaMays „Brexit means Brexit“ in Erinnerung. Dass eine Umsetzung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union jedoch erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringe, zeige die aktuelle Entwicklung. Die Zwei-Jahres-Frist des Art. 50 Abs. 3 EUV sei zunächst bis zum 12. 4. 2019, dann ein weiteres Mal bis zum 31. 10. 2019 verlängert worden. Daher hätten auch im Vereinigten Königreich Wahlen zum Europäischen Parlament stattgefunden und britische Abgeordnete an der Wahl der Kommissionspräsidentin teilgenommen. Gegenwärtig erscheine zwar der harte Brexit als die wahrscheinlichste Variante, wenngleich das britische House of Commons ein solches Vorgehen abgelehnt habe. Zum Brexit-Dilemma sei es durch Klärung der bis dato umstrittenen Frage der Reversibilität einer Mitgliedschaft in der Union mit Erlass des Lissabon-Vertrages gekommen. Entscheidende Argumente hierfür seien der Charakter der EU als freiwilliger Staatenverbund und die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten gewesen. Art. 50 EUV sehe unionsrechtlich ein einseitiges und bedingungsloses Austrittsrecht vor, das weder inhaltlich begründet noch die ultima ratio sein müsse. Ein Austritt der Bundesrepublik Deutschland wäre allerdings aufgrund der Staatszielbestimmung des Art. 23 I 1 GG begründungspflichtig. Zentrales Streitthema im Hinblick auf das Ende der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs sei die Grenze zu Irland. Die sog. Backstop-Klausel sehe vor, dass Nordirland im EU-Binnenmarkt und das gesamte Vereinigte Königreich in der Zollunion blieben, bis eine andere Lösung gefunden werde. Indes sei es für das Vereinigte Königreich nur durch ein Verlassen der Zollunion möglich, eigene Handelsabkommen zu schließen. Auch die wechselseitigen Rechte und Pflichten der Unionsbürgerschaft sowie die Folgen für Zusammensetzung und Funktionsweise der Organe und des EU-Haushalts böten Konfliktpotenzial. Diskutierte Lösungsmöglichkeiten seien ein „Teilaustritt“, der Verbleib im Europäischen Wirtschaftsraum, das „Schweizer Modell“ (mit einer Vielzahl von bilateralen Abkommen) oder eine Sondervereinbarung, wie sie das Austrittsabkommen vom 14. 11. 2018 darstelle. Letzteres habe jedoch – insbesondere aufgrund der Backstop-Klausel – ebenfalls keine Zustimmung des House of Commons erfahren. Der EuGH erklärte zwischenzeitlich in der Wightman-Entscheidung die einseitige Widerruflichkeit der Austrittsabsichtserklärung für unionsrechtlich zulässig. Die damit einhergehende Reversibilität eines Austrittsprozesses biete – auch mit Blick auf mögliche Austrittserwägungen anderer Mitgliedstaaten – durchaus Missbrauchspotential. Da der wohl künftige Premierminister Boris Johnson beratungsresistent erscheine, würden Forderungen nach einer Rücknahme der Erklärung wie auch nach einem zweiten Referendum im Sande verlaufen. Der Sonderfall Brexit zeige sich jedenfalls als „Trauerfall“, der – je nach Intensität und Ausgestaltung – noch viele Aufgaben für die Rechtswissenschaft bereithalten werde.
Prof. Dr. KatjaZiegler (Universität Leicester) behandelte im Anschluss „Rechtliche und politische Herausforderungen des Brexits für das Vereinigte Königreich“. In einer Vorbemerkung schilderte sie zunächst den Kontext und das aktuelle Klima im Land. Die britische Regierung (unter Theresa May als Innenministerin) hatte schon seit 2012 eine Politik des „hostile environment“ verfolgt. Diese Einwanderungspolitik führte u.a. zum „Windrush" Skandal, der rechtswidrigen Ausweisung langansässiger Aufenthaltsberechtigter, die sich – ähnlich wie heute Unionsbürger – ohne großen bürokratischen Aufwand im Vereinigten Königreich ansiedeln konnten. Das Thema Einwanderung stand auch im Vordergrund der Referendumskampagne „Vote Leave". Durch Polarisierung und Radikalisierung trage nun auch der Brexit zur fortschreitenden gesellschaftlichen und politischen Spaltung im Vereinigten Königreich bei. Sowohl politisch als auch rechtlich stelle der Brexit die tief gespaltene Gesellschaft des Vereinigten Königreichs vor erhebliche Herausforderungen. Bereits im Vorfeld habe die Frage, ob eine parlamentarische Zustimmung zur Notifizierung der Austrittsintention nach Art. 50 EUV unabdingbar sei, eine Antwort erfordert. Ziegler verwies auf den Miller-Fall, in dem die Notwendigkeit erstritten wurde, die Zustimmung des Parlaments für die Austrittsverhandlungen mit der EU einzuholen. Die Entscheidung wurde mit dem Argument begründet, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs zwar in den Bereich der royal prerogative falle, diese aber keine Grundlage biete, in durch Parlamentsgesetz eingeräumte Individualrechte einzugreifen und das Unionsrecht als Rechtsquelle abzuschaffen, mithin eine fundamentale verfassungsrechtliche Änderung herbeizuführen. Auch das Austrittsabkommen bedürfe nach dem Verfassungsrecht des Vereinigten Königreichs der parlamentarischen Zustimmung. Zwar hatten sich britische Regierung und EU auf ein Austrittsabkommen geeinigt, das House of Commons verweigerte jedoch in drei Abstimmungen die Zustimmung. Vor diesem Hintergrund sei zu befürchten, dass mit Ablauf der Frist des Art. 50 Abs. 3 EUV das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU ausscheide. Möglicherweise könne eine kreative Anwendung des Art. 50 Abs. 3 EUV in Form einer geltungserhaltenden Reduktion dieses Szenario verhindern. Danach würde die Austrittsabsichtserklärung – bei weiterhin fehlender Zustimmung zu einem Austrittsabkommen – mit Fristablauf gegenstandslos werden. Hierfür sprächen u.a. die Widerruflichkeit der Erklärung, die der EuGH im Wightman-Urteil bestätigt habe, die Werteklausel des Art. 2 EUV i.V.m. der Rule of Law Agenda der Venedig-Kommission sowie der hohe Grad der Vermischung nationaler und unionsrechtlicher Strukturen. Da auch eine Lösung durch Neuwahlen nicht sicher sei, komme es gerade auf die Auslegung von Art. 50 Abs. 3 EUV an.
V. Banken- und Finanzkrise
Im letzten Block der Tagung referierte Prof. Dr. UlrichHäde (Universität Frankfurt (Oder)) zum Thema „EuGH und BVerfG im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und Kooperation: Die Judikatur zu den Anleihekaufprogrammen der EZB“. Der Ton im Verhältnis zwischen BVerfG und EuGH sei rauer geworden. Über eine materielle Aufladung des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG ermögliche das BVerfG den Zugang zur Kontrolle unionalen Handelns. Häde hob hervor, dass eine auf die Behauptung einer Verletzung von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gestützte Ultra-vires-Kontrolle in Richtung eines allgemeinen Gesetzesvollziehungsanspruchs gehe, den das Grundgesetz so nicht kenne. Schon der Ansatz des Zweiten Senats sei hierbei problematisch, da auf diesem Wege faktisch eine Popularklage gegen alle zukünftigen Unionsrechtsakte etabliert werden könne. Der erste Vorlagebeschluss des BVerfG (BVerfGE 134, 366) an den EuGH erging im Kontext des Outright Monetary Transactions (OMT) Programms der EZB. Er war ungewöhnlich scharf formuliert, streng genommen enthielt der Beschluss bereits selbst die Antwort. Es sei der Eindruck entstanden, nur wenn der EuGH dem „Diktat“ des BVerfG folge, sei dieses bereit, von der Aktivierung eines Kontrollvorbehaltes abzusehen. Der EuGH hielt jedoch das OMT-Programm in der Rs. C-62/14 (Gauweiler) für unionsrechtskonform und folgte der Ansicht des BVerfG damit jedenfalls nicht vollumfänglich. Häde bezeichnete die anschließende Entscheidung des BVerfG als weise und gesichtswahrend. Trotz kritischer Distanz zum Gauweiler-Urteil sah es von der Aktivierung eines Kontrollvorbehaltes ab (BVerfGE 142, 123). Das könne man als Rückkehr zum Kooperationsverhältnis verstehen. Schon bevor der EuGH die Unionsrechtskonformität des OMT-Programms bestätigen konnte, beschloss die EZB ein weiteres Anleihekaufprogramm, das Public Sector Purchase Programme (PSPP) als Teil des Extended Asset Purchase Programme (EAPP). Im Unterschied zum OMT-Programm wurde das PSPP in die Praxis umgesetzt. Im Rahmen der anhängigen Verfassungsbeschwerden erging erneut ein Vorabentscheidungsersuchen des BVerfG an den EuGH (BVerfGE 146, 216). Abermals stellte sich aus unionsrechtlicher Perspektive die Frage, ob das Handeln der EZB noch von deren geldpolitischem Mandat gedeckt sei und möglicherweise gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung aus Art. 123 AEUV verstoße. Die ersten vier Fragen des BVerfG zu diesbezüglichen Verstößen verneinte der EuGH in der Rs. C-493/17 (Weiss). Die fünfte Vorlagefrage, welche die Grenzen der Risikoteilung im ESZB betraf, erklärte der Gerichtshof für unzulässig. Mit Spannung würden nun die mündliche Verhandlung sowie das abschließende Urteil des BVerfG erwartet, wobei laut Häde eine kooperative Lösung wahrscheinlich sei. Bei einer Gesamtwürdigung stelle sich die Erhöhung der Kontrollmöglichkeiten des BVerfG durch Entwicklung der Ultra-vires- sowie der Identitätskontrolle als Ausdruck von Kooperation bei gleichzeitiger Selbstbehauptung dar.
Zum Abschluss der 25. Würzburger Europarechtstage präsentierte Dr. RolfStrauch (Europäischer Stabilitätsmechanismus) „Die Neuausrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus als Herzstück der Eurozonenreform“. Der ESM sei anknüpfend an den Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) auf Basis eines völkerrechtlichen Vertrages eingerichtet worden. Zu Beginn der Neuausrichtung habe die grundsätzliche Frage gestanden, ob der ESM in das Unionsrecht eingegliedert werden oder intergouvernemental weitergeführt werden solle. Da zur Änderung des Primärrechts aktuell der politische Wille fehle, habe man sich für die intergouvernementale Weiterführung entschieden. Strauch war es ein besonderes Anliegen, mit dem „Hinterzimmer-Mythos“ – der zuletzt auch mit Blick auf die Wahl der Kommissionspräsidentin diskutiert wurde – aufzuräumen. Die mitgliedstaatlichen Regierungen seien sich auch bei intergouvermentalen Verhandlungen ihrer Verantwortung gegenüber dem Parlament durchaus bewusst. Da der EuGH in der Rs. C-370/12 (Pringle) klargestellt habe, dass sowohl der Abschluss als auch die Ratifikation des Vertrags zur Errichtung des ESM nicht gegen Unionsrecht, insbesondere nicht gegen die Nichtbeistandsklausel gemäß Art. 125 AEUV verstoße, sei sichergestellt, dass diesbezüglich keine strukturelle Streitfrage mehr bestehe. Vor diesem Hintergrund präsentierte Strauch im Weiteren die zentralen Elemente der Neuausrichtung des ESM. Zunächst solle das Instrument der vorsorglichen Kreditlinien zum Zwecke der Erhöhung der Effektivität fortentwickelt werden. Zudem werde überlegt, dem ESM künftig neben seiner Rolle als Kreditgeber mehr Verantwortung als politischer Entscheidungsträger zukommen zu lassen. Die Rolle der Kommission als „Hüterin der Verträge“ werde durch die Neuausrichtung des Verhältnisses der Institutionen im Rahmen der ESM-Reform jedoch nicht beeinträchtigt. Im Übrigen solle durch die Etablierung einer Letztabsicherung – den sog. Backstop des Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus – eine Verknüpfung mit der Europäischen Bankenunion erfolgen. Zum Abschluss seines Referates hob Strauch hervor, dass die ESM-Reform als Teil der Eurozonenreform und nicht lediglich als „Reparaturwerkstatt“ zu verstehen sei. Der ESM sei das Herzstück, sein Herzschlag die Solidarität. Ziel müsse es sein, ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten herzustellen und den ESM als Institution zu festigen.
VI. Resümee
In ihren Schlussworten bedankten sich die Veranstalter Ludwigs und Schmahl für die spannenden Vorschläge und anregenden Diskussionen über mögliche Wege aus der Polykrise der Europäischen Union. Sie dankten allen, die zum Gelingen der Europarechtstage beigetragen hatten, insbesondere den veranstaltenden Lehrstuhlteams, den Vortragenden sowie den Sponsoren. Die Referate der Tagung werden in einem Sammelband der Reihe IUS EUROPAEUM (Nomos) dokumentiert.
Ann-Kathrin Schneider ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht (Prof. Dr. Markus Ludwigs) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.