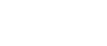Carl Otto Lenz: Weniger Rechtsschutz – weniger Rechtsstaat?
Die Europäische Kommission hat ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet und eine entprechende Warnung an Rumänien gerichtet. Worum geht es?
Zunächst geht es darum, ob diese Mitgliedstaaten den in Art. 2 EUV vereinbarten Verfassungsgrundsatz der Rechtsstaatlichkeit einhalten. Dazu gehört auch der Grundsatz der Unabhängigkeit der Gerichte. Dessen Einhaltung ist Voraussetzung für die Aufnahme in die Europäische Union. Besteht die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung dieses Wertes durch einen Mitgliedstaat, so kann dies der Europäische Rat nach Art. 7 EUV einstimmig feststellen. Das Verfahren dient also der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen der Mitgliedschaft gefährdet sind. Das ganze Verfahren spielt sich auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Organe der EU statt und betrifft diese in erster Linie.
Dies gilt nicht für das Merkmal "Nichtdiskriminierung". Es gilt natürlich auch für die genannte Ebene, aber es gilt auch für die Beziehung von Unionsbürgern und Trägern der vier Grundfreiheiten zur EU. Der Präsident des EuGH, Koen Lenaerts, hat auf einer Veranstaltung am 8. 11. 2018, 80 Jahre nach der "Reichsprogromnacht", in Berlin einige Beispiele genannt:
Zunächst den Fall Nikolova (C-83/14): Hier hat der Gerichtshof insbesondere festgestellt, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht nur auf Personen mit einer bestimmten ethnischen Herkunft anwendbar ist, sondern allgemein auch auf Personen, die zwar selbst nicht die betreffende Herkunft aufweisen, die aber durch eine diskriminierende Maßnahme zusammen mit den Personen, die über diese Herkunft verfügen, weniger günstig behandelt oder in besonderer Weise benachteiligt werden.
Der Fall Egenberger (C-414/16) betrifft eine Bewerberin, die offenbar in einem Bewerbungsverfahren über eine befristete Referentenstelle beim Evangelischen Werk wegen ihres mangelnden christlichen Glaubens nicht in Betracht gezogen wurde.
In seinem Urteil wies der Gerichtshof darauf hin, dass zwischen dem Recht auf Autonomie der Kirchen und dem Recht der Arbeitnehmer, im Rahmen von Bewerbungsverfahren keinen Diskriminierungen ausgesetzt zu sein, ein angemessener Ausgleich herzustellen ist. Die nationalen Gerichte haben zu prüfen, ob die jeweilige Anforderung aufgrund der Art der beruflichen Tätigkeit tatsächlich objektiv geboten ist.
In seinem Urteil vom 25. 10. 2018 folgte das BAG dieser Auslegung des EuGH, indem es insbesondere Zweifel an der Wesentlichkeit der beruflichen Anforderung geltend machte, weil im konkreten Fall keine wahrscheinliche und erhebliche Gefahr bestanden hätte, dass das Ethos des Beklagten beeinträchtigt würde.
Die Sache IR/JQ (C-68/17) betraf die Kündigung eines Chefarztes katholischer Konfession durch ein katholisches Krankenhaus wegen Verstoßes gegen dienstvertragliche Loyalitätspflichten: Er hatte nach der Scheidung von seiner ersten Frau wieder geheiratet.
Nach der Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG ist es grundsätzlich verboten, einen Arbeitnehmer wegen seiner Religion oder Weltanschauung zu diskriminieren. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Kirchen aber von den Beschäftigten ein loyales Verhalten nach dem jeweils geltenden kirchlichen Ethos verlangen.
In seinem Urteil stellte der Gerichtshof – unter Verweis auf Egenberger – zunächst fest, dass Kirchen an leitende Beschäftigte je nach deren Konfession unterschiedliche Anforderungen an das loyale Verhalten stellen können. Gegenstand der gerichtlichen Kontrolle durch das nationale Gericht muss dabei sein, dass die Religion für die Art der Tätigkeit wiederum eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. Dabei wies der Gerichtshof darauf hin, dass die Loyalitätspflicht gegenüber der katholischen Kirche für eine Tätigkeit als Leiter der Abteilung „Innere Medizin“ keine wesentliche Anforderung der beruflichen Tätigkeit zu sein schien. Davon war insbesondere deshalb auszugehen, weil ähnliche Stellen Beschäftigten anvertraut wurden, die nicht katholischer Konfession waren. Sie waren folglich nicht denselben Anforderungen unterworfen, sich loyal und aufrichtig im Sinne des katholischen Ethos zu verhalten.
In allen Fällen ging das Verfahren vor dem EuGH nicht auf die Initiave europäischer Stellen, sondern auf Beschluss eines Gerichts eines Mitgliedstaates zurück. Es erweitert dessen Befugnisse. Das Verfahren enthält auch eine Befugnis einer Institution der EU – des EuGH – und fördert die Verbreitung von Kenntnissen des Unionsrechts.
Der bisherige Vizepräsident des BVerfG, Ferdinand Kirchhof, kritisiert in einem Interview mit J. Jahn in NJW-aktuell (H. 16 vom 11. 4. 2019, S. 12 f.) die Befugnis "unterinstanzlicher" Gerichte zur Anfrage beim EuGH und "würde auch eine Änderung des Vorlageverfahrens, beispielweise einen Einbezug der nationalen Verfassungsgerichte, in Erwägung ziehen." Das ist dahin verstanden worden, "deutsche Gerichte (sollten) den EuGH nur noch mit Zustimmung des BVerfG anrufen können (Jahn, rsw.beck.de/aktuell/meldung).
Das würde eine Einschränkung der Befugnis deutscher Gerichte bedeuten, direkt in Kontakt mit dem EuGH zu treten, sowie der Befugnis von Rechtsuchenden vor deutschen Gerichten und ihrer Anwälte, ihre Sache selbst vor dem EuGH zu vertreten. Es würde die Möglichkeiten des EuGH, mit den Gerichten der Mitgliedstaaten in Kontakt zu kommen, einschränken und so die Distanz zwischen Bürgern und Organen der EU vermindern – eine Distanz, die Kirchhof behauptet und beklagt. Die Vorlagefreudigkeit deutscher Gerichte spricht indes gegen die von Kirchhof behauptete Distanz. 2018 gab es 78 Vorlagen deutscher Gerichte.
Das Fazit ist: Die Befugnisse des BVerfG würden wachsen, die aller anderen Beteiligten aber vermindert. Das BVerfG sollte die Befugnisse anderer schätzen und nicht die eigenen auf Kosten anderer ausweiten.
Aber vielleicht ist ja alles ein Mißverständnis. In einem Interview mit LTO (T. Podolski, 11.4.2019) hat Kirchhof gesagt, es sei ausreichend, wenn nicht mehr jeder Richter, sondern nur jeweils die obersten Gerichte der Mitgliedstaaten den EuGH anrufen könnten. Sollte es um die Nichtanwendung von nationalen Rechtsvorschriften gehen, die von einem Parlament beschlossen worden sind, sollten statt der Obersten Gerichte die Vefassungsgerichte eingeschaltet werden. Das aktuelle System "begünstige die Umgehung der nachfolgenden Instanzen und tendiere zur Zersplitterung der Rechtsprechung". Dazu ist zu bemerken, dass seit 1. 1. 2018 das Justizielle Netzwerk der Europäischen Union besteht. Die in allen Sprachen der Union verfügbare Plattform wurde bereitgestellt, um die Arbeiten der europäischen und nationalen Richter im Rahmen ihrer Aufgaben zu bündeln (siehe Jahresüberblick des EuGH, S. 58).
Dieser Vorschlag würde den Vorwurf des Strebens nach mehr Macht ein wenig entkräften, ändert aber nichts an der Zentralisierung der Vorlageentscheidungen, der Einschränkunng der Handlungsmöglichkeiten der Rechtsuchenden und dem Kompetenzverlust der Instanzgerichte, die bisher auch wichtige Grundsatzfragen dem EuGH vorgelegt haben (z.B. Costa/ENEL 6/64 auf Vorlage des Friedensgerichts Mailand). Außerdem verteuert die notwendige Erschöpfung des Rechtswegs das Verfahren. Manchmal endet der Rechtsweg auch vor Erreichung der Obersten Bundesgerichte. Auch diese Modifizierung ändert also nichts daran, dass die Befugnisse der Instanzgerichte (und die Möglichkeiten der dort tätigen Rechtsanwälte) geschmälert und die Möglichkeit des EuGH, sich mit den Problemen der Instanzgerichte zu befassen, abgeschafft würden. Außerdem würde eine solche Änderung dem gerade von Deutschland immer wieder betonten Grundsatz widersprechen, dass Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden sollen.
Die Bürger sind Akteure des Integrationsprojekts. Die nationalen Gerichte sind das Unionsrecht anwendende Gerichte.
Die Beschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten wäre eine wesentliche Änderung des Rechtsschutzsystems des AEUV. Mit Recht wird in der LTO darauf hingewiesen, dass die genannten Vorschläge eine Änderung des Lissabon-Vertrages erforderten. Dazu wird es hoffentlich nicht kommen.
Prof. Dr. Carl Otto Lenz ist Hon.-Prof. der Universität des Saarlandes, ehem. Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, ehem. Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs.