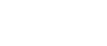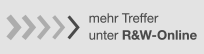Wo endet die IFRS-Rechnungslegung?
Perspektive der Unternehmensrechnung

Nach der 4. und 7. EG-Richtlinie war die 2002 vom EU-Parlament verabschiedete IAS-Verordnung ein weiterer Meilenstein zur Harmonisierung der europäischen Rechnungslegung. Sie verpflichtet alle kapitalmarktorientierten EU-Unternehmen, den Konzernabschluss ab 2005 nach den IFRS aufzustellen. Damit wurden Bilanzierungspflichten in der EU erstmals nach Kapitalmarktzugang statt – wie bis dato üblich – nach Haftungsbeschränkung differenziert. Viele andere Staaten sind dem EU-Beispiel gefolgt, so dass die IFRS nun in über 130 Ländern verwendet werden. Damit hat sich der IASB zum global anerkannten Standardsetzer für die Rechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen entwickelt.
Obwohl mit einer international einheitlichen Bilanzierungssprache unter Informationseffizienzgesichtspunkten viele Vorteile für die Kapitalmärkte verbunden sind, mehren sich kritische Stimmen. Abschlussersteller bemängeln den erheblichen Erstellungsaufwand aufgrund zunehmender Komplexität der Standards und der häufigen Änderungen von Bilanzierungsregeln. In der WP-Branche trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, aufgrund der Standardkomplexität die notwendigen Ressourcen für IFRS-Mandate vorzuhalten. Für die Adressaten bekommen die IFRS-Konzernabschlüsse mehr den Charakter eines umfassenden Lexikons als eines Überblickartikels zur wirtschaftlichen Lage.
Trotz dieser Kritik gibt es kaum eine Alternative zur IFRS-Bilanzierung, um auf den zusammenwachsenden Kapitalmärkten eine effiziente Kapitalallokation sicherzustellen. Der IASB hat in den vergangenen fünf Jahren eine erhebliche Regelungsdichte geschaffen. Auf der Agenda stehen weiterhin viele grundlegende Bilanzierungsfragen. Hier hat der IASB darauf zu achten, dass zweckadäquate und konsistente Standards entstehen. Vor dem Hintergrund, dass sich Ersteller und Wirtschaftsprüfer durch detaillierte Regulierungen vor einer fehlerhaften Erstellung bzw. Prüfung schützen wollen, ist davon auszugehen, dass die Regulierungsdichte weiter zunehmen und sich ein “cookbook accounting” etablieren wird.
Die IASB-Verlautbarungen sind Ergebnis eines formellen Standardsetzungsprozesses, an dem sich alle Interessengruppen beteiligen können. Hierbei sind immer unterschiedlichere Bilanzierungsinteressen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollte der IASB regelmäßig Machbarkeitsstudien und Feedbackschleifen als Ex-post-Kontrollen durchführen. Auch die Unabhängigkeit des bisher überwiegend durch Spenden der Big Four und der betroffenen Unternehmen finanzierten IASB ist zu diskutieren.
Die Fortentwicklung des IFRS-Regelwerks für kapitalmarktorientierte Unternehmen ist die eine, die Anwendung auf übrige Unternehmen die andere Frage. Falls der vom IASB im Juli 2009 veröffentlichte IFRS for SMEs rechtsverbindlich würde, wären hiervon in der EU alle haftungsbeschränkten Unternehmen ohne Kapitalmarktzugang betroffen. Die Stimmungslage innerhalb der EU bezüglich einer Zulassung ist divergent und reicht von der Befürwortung eines strikten Verbots über die Präferierung eines Staaten- oder sogar eines Unternehmenswahlrechts. Notwendige Voraussetzung für eine EU-Anerkenung ist die bisher wohl nicht gegebene Konformität mit der 4. und 7. EG-Richtlinie. Weil sich der IFRS for SMEs – wie auch die Full-IFRS – ausschließlich auf die Informationsfunktion fokussiert, wäre zu klären, wie die sonstigen Jahresabschlussaufgaben erfüllt werden können. Hinsichtlich der bilanziellen Kapitalerhaltung werden die Einführung eines Solvenztests sowie die Festlegung von Ausschüttungssperren diskutiert.
Für die Einbettung von Bilanzierungsstandards eines privatwirtschaftlichen Gremiums in den europäischen Verfassungsrahmen wäre erneut der etablierte Endorsement-Mechanismus zu bemühen. Dass der IASB bei dem IFRS for SMEs auf gesellschaftsrechtliche Besonderheiten einzelner Staaten eingehen würde, ist nach bisherigen Erfahrungen eher zu bezweifeln. So wird sich der IASB wenig daran stören, dass z. B. in Deutschland die handelsrechtliche Bilanzierung noch immer eine Maßgeblichkeit für die steuerliche Gewinnermittlung entfaltet. Offen bleibt, wie der IASB mit den unterschiedlichen Regelwerken dauerhaft umgehen wird und ob eine derartige Monopolstellung des IASB zweckdienlich sein kann. Von daher spricht in der EU wenig dafür, nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen diesem IASB-Experiment auszusetzen. Dies gilt für Deutschland umso mehr, als hier 2009 mit dem BilMoG in den Grenzen der 4. und 7. EG-Richtlinie gerade ein Schritt zur Überarbeitung der Bilanzierungsregeln vollzogen wurde.
Zusammenfassend erscheint es wenig zweifelhaft, dass der IASB seinen steinigen Weg zur weiteren Harmonisierung der Rechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen weiterzugehen hat. Nur so kann ein Rückfall in stärker national geprägte Kapitalmärkte verhindert werden. Für nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen besteht eine weitergehende Vereinheitlichungsnotwendigkeit nicht. Hier sind die vielfältigen nationalen Besonderheiten eine hinreichende Begründung für einzelstaatlich geprägte Bilanzierungsregeln, die in der EU “lediglich” in die Rahmenbedingungen der EG-Richtlinie eingebettet sein müssen. Insofern gilt auch für den IASB: Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Prof. Dr. Bernhard Pellens ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Unternehmensrechnung an der Ruhr-Universität Bochum. In Forschung und Lehre widmet er sich primär Fragen der (internationalen) Rechnungslegung, der Corporate Governance und der wertorientierten Unternehmensführung. Am 18.3.2010 hat er den Dr. Kausch-Preis zur Förderung der Forschung und Praxis auf dem Gebiete des finanziellen und betrieblichen Rechnungswesens an der Universität St. Gallen für seine Verdienste um die Umsetzung der internationalen Rechnungslegung erhalten (vgl. dazu BB 2009, 2694 und BB 5/2010, VII). Der nachfolgende Text vertieft eine Kernthese aus seiner Festrede.