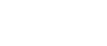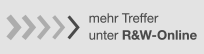Deutsch-amerikanische Gerichtsstandsvereinbarungen – eine neue Front im transatlantischen Justizkonflikt?

Der transatlantische Justizkonflikt hatte bisher im Wesentlichen die Allzuständigkeit amerikanischer Gerichte, das jury trial, die pre-trial discovery und punitive damages zum Gegenstand. Er schwelt heute insbesondere auf dem Gebiet der Zustellung und Beweisaufnahme über die Grenze, nachdem die Amerikaner die Haager Übereinkommen über die Zustellung und die Beweisaufnahme nicht als ausschließlich und nur als Ergänzung des innerstaatlichen Rechtes betrachten und die deutschen Gerichte im Gegenzug die Zustellung von erpresserischen Sammelklagen jedenfalls während der Anhängigkeit des Napster-Falles beim Bundesverfassungsgericht verweigert haben.
Der BGH eröffnet nun durch seine Rechtsprechung zu Schiedsvereinbarungen unbedacht eine neue Front. Deutsch-amerikanische Gerichtsstandsvereinbarungen werden seit MS Bremen & Unterweser v. Zapata Offshore Co. weitgehend unbeanstandet praktiziert. Das scheint nun aber in Frage gestellt. Der BGH ist der Ansicht, dass – da es kein Armenrecht im Schiedsverfahren gibt – die Partei, die die Kosten nicht aufbringen kann, an die Schiedsvereinbarung nicht mehr gebunden ist, jedenfalls diese kündigen kann. Das muss konsequenterweise dazu führen, dass auch Gerichtsstandsvereinbarungen zugunsten eines US-amerikanischen Gerichts jedenfalls kündbar sind, wenn die deutsche Partei die sehr hohen und nach der american rule of costs nicht erstattbaren Anwaltskosten nicht tragen kann. Denn da der US-amerikanische Zivilprozess kein funktionierendes Armenrechtssystem kennt, kann die deutsche Partei leicht in die Situation geraten, mit Anwaltskosten auch bei mittleren Verfahren im sechsstelligen Dollarbereich konfrontiert zu werden, die sie nicht aufbringen kann. In einem solchen Fall muss nach der ratio von BGH NJW 2000, 3720 dasselbe für die arme Partei einer Gerichtsstandsvereinbarung wie für die arme Partei einer Schiedsvereinbarung gelten. Sie ist nicht hieran gebunden. Denn es gilt, einen déni de justice zu verhindern. Auch die Tatsache, dass sich die deutsche Partei das US-amerikanische Forum ausgesucht hat, ist unerheblich. Diese Argumentation lässt der BGH auch bei Schiedsvereinbarungen nicht zu.
Wir befinden uns auf einem gefährlichen Weg, der den deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr empfindlich stören kann. An der Eröffnung dieser Front des transatlantischen Justizkonflikts trifft dann uns die Schuld. Offenbar hat der BGH die Konsequenzen seiner Rechtsprechung zur Armut im Schiedsverfahren nicht durchdacht, wenn er in der Kalifornien-Entscheidung die american rule of costs als unbedenklich darstellt. Da das deutsche Recht aber keine stare decisis kennt, ist es für eine Umkehr nicht zu spät.
Professor Dr. Rolf A. Schütze, Stuttgart