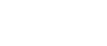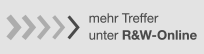Exportkontrolle in Konflikt- und doch zukunftsträchtigen Zeiten – Schema F war gestern

Die Autorin
ist als Rechtsanwältin in der Kanzlei
HARNISCHMACHER LÖER WENSING, Münster,
tätig. Ihre fachlichen Kompetenzen als Rechtsanwältin
sind das Zoll- und Exportkontrollrecht, insbesondere
auch an der Schnittstelle zum Transport- und Speditions-
recht. Sie ist ferner als “Compliance Officer” zugelassen,
als Dozentin tätig und veröffentlicht regelmäßig Beiträge
in Zeitschriften und Büchern.
Es muss eine Balance zwischen den rechtlichen Vorgaben und deren Organisation gefunden werden
Aus dem Blickwinkel eines global handelnden Unternehmens herrschte längere Zeit zumindest gefühlt Frieden. 2011 begann die EU Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, wegen Menschenrechtsverletzungen und der Anreicherung von Uran. Die berufliche Erfahrung der Verfasserin hat gezeigt, dass die Unternehmen mit Sanktionen gegen den Iran “umgehen konnten”. Es stellte sich für die Unternehmen schlicht die Frage, ob weiterhin Handel mit dem Iran betrieben werden darf oder zwecks Risikominimierung keine weiteren Geschäfte mit dem Iran mehr betrieben werden sollen, was oftmals das Ergebnis war. Organisatorisch bedeutete dies für ein Unternehmen in der Regel, sich vor allem darauf zu konzentrieren, Exporte insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Dual-Use-Gütern rechtssicher zu gestalten. Embargoländer wurden schlichtweg ausgeschlossen. Mit den Sanktionen gegen Russland 2014 änderte sich daran zumeist nicht maßgeblich viel. Innerorganisatorisch bedeutete dies für viele Unternehmen in Bezug auf die Implementierung eines “Internal Compliance Program” (ICP) in der Exportkontrolle:
-
Halten wir die personenbezogene Exportkontrolle ein? Ja, wir prüfen die Sanktionslisten IT-gestützt und dokumentieren unsere Prüfungen.
-
Halten wir die länderbezogene Exportkontrolle ein? Ja, wir haben eine No-Go-Länderliste, auf der sich vor allem neben Länder befinden, mit denen wir eh kein Geschäft machen (Nordkorea, Pakistan, Syrien, Iran etc.). Im Übrigen sind unsere Produkte von keinem Embargo erfasst.
-
Halten wir die güterbezogene Exportkontrolle ein? Ja, wir prüfen unsere Produkte mit Unterstützung des EZT-Online/Umschlüsselungsverzeichnis/einer Software gegen die Rüstungsgüterliste und die Dual-Use-Güter-Liste.
-
Halten wir die verwendungsbezogene Exportkontrolle ein? Ja, wir lassen uns von unserem Kunden (im Zweifel) eine Endverbleibserklärung vorlegen.
Mit dem Ukraine-Krieg ab 2022 begann ein neues Zeitalter. Aktuell wurde das Russland-Embargo dem 18. Sanktionspaket unterzogen. Zudem existiere weitere restriktive Maßnahmen. Alle Bestimmungen fokussieren sich auf eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen und verbieten unmittelbare geschäftliche Beziehungen, aber auch “mittelbare Verkäufe, Ausfuhren, Lieferungen”, die im allgemeinen Sprachgebrauch als “Umgehungsgeschäfte” bezeichnet werden. Organisatorisch sind alle diese Bestimmungen eine kaum beherrschbare Herausforderung. Seit dem ersten Sanktionspaket stellen sich folgende Fragen rollierend:
-
Tätigen wir unmittelbar oder mittelbar Geschäfte mit Russland?
-
Werden unsere Produkte (Ware, Software, Technologie) vom Embargo erfasst?
-
Können unsere Produkte im russischen Angriffskrieg eingesetzt werden?
-
Was wissen wir über unsere Kunden und deren Geschäfte mit Russland?
-
Wie hoch ist das Risiko, dass unsere Produkte nach Russland geliefert werden?
Und letztlich die Frage:
-
Wer soll sich für die Einhaltung der Russland-Sanktionen im Unternehmen letztendlich verantwortlich zeichnen?
Weiter geht's. Aber wohin? Derzeit sind viele Unternehmen von der Zoll-Politik der USA betroffen. Es bleibt kaum Zeit und Raum für andere Themen. Zudem werden Länder als kritisch angesehen, ohne dass Gesetze den Handel tatsächlich einschränken, wie zum Beispiel Israel. Und so stellt sich zunehmend die Frage:
Wer soll sich im Unternehmen um die Verfolgung ALLER dieser Themen und Einhaltung daraus resultierender Bestimmungen kümmern, die sich aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage fast tagesaktuell ändern können?
Fehlendes, nicht zum Zoll- und Außenwirtschaftsrecht ausgebildetes Personal oder sich von dem Thema abwendendes Personal ist meiner Erfahrung DAS Thema und lässt Überlegungen wachsen, vermehrt “Künstliche Intelligenz (KI)” einzusetzen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Zeiten der Auseinandersetzungen so schnell enden, dass die Organisation der Exportkontrolle (und auch des Zolls) wieder einem “Schema F” folgt. Ausgehend von den aktuellen Tendenzen wird wohl das Gegenteil der Fall sein und die Unternehmen werden vermehrt wiederkehrend und tagesaktuell angehalten sein, ihre Unternehmenstätigkeit vor dem Hintergrund der sich stetig ändernden weltpolitischen Lage auf den Prüfstand zu stellen, um neue Regularien rechtskonform umzusetzen bzw. aus den Regularien abzuleiten, welche Geschäfte noch risikolos durchgeführt werden können.
Zukünftig wird damit die Bewertung eines Organisationsverschuldens mehr denn je von den zunehmenden rechtlichen Vorgaben, aber auch deren Organisation durch den zunehmenden Einsatz von Technologie abhängen. Es muss eine Balance zwischen den rechtlichen Vorgaben und deren Organisation gefunden werden, die es zulässt, dass in rechtlicher Hinsicht weder der Vorwurf eines Organisationsverschuldens gemacht werden kann, noch dass in tatsächlicher Hinsicht die Kosten für die Einhaltung aller Vorgaben über dem Ertrag liegt. Ein Verweilen im Schema F kann sich aktuell keiner erlauben.
Dr. Talke Ovie, Rechtsanwältin, Münster