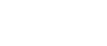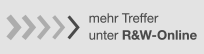Wie geht es weiter im Asiengeschäft?

Asien ist und bleibt der globale Zukunftsmarkt Nr. 1. Die Integration von drei Milliarden Menschen in die Weltwirtschaft schafft große Chancen, aber auch Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Innerhalb Asiens werden Japan und China in den nächsten Jahrzehnten wirtschaftlich dominant bleiben. Die ökonomische Integration beider Länder wird sich ungeachtet politischer Differenzen weiter vertiefen. Vor diesem Hintergrund gewinnen deutsche Firmen im Asiengeschäft nicht mit Chuzpe, sondern mit Vorsicht und Geduld.
In Japan findet eine nachhaltige Erholung statt. Japanische Unternehmen investieren wieder kräftig im In- und Ausland, die Politik der Marktöffnung und Deregulierung zeigt positive Wirkung. Japan setzt auf Forschung und Zukunftstechnologien. Die Konsolidierung des Finanzsektors wird zügig vorangetrieben, Schuldenkrise und Deflation sind weitgehend überwunden, die Arbeitslosigkeit geht spürbar zurück, Exporte und privater Konsum ziehen an, internationale Investoren brechen überkommene Strukturen auf. Die Orientierung an Profit und Shareholder Value verdrängt die traditionelle Ausrichtung auf Marktanteil und Beschäftigungssicherung. Rund ein Viertel des Aktienkapitals der börsennotierten Unternehmen ist bereits in internationaler Hand. Im Private-Equity-Geschäft gehört Japan angesichts zahlreicher Hidden Champions im Industriesektor zu den attraktivsten Märkten weltweit. Viele der potenziellen Targets sind stark an Ressourcen, aber schwach an Kapital und Ertragskraft. Außerordentliche Chancen bieten sich auch ausländischen Firmen, die den stark wachsenden “Silver Market” mit langlebigen Konsumgütern, Freizeit- und Wellnessangeboten, Health-Care-Produkten oder Finanzdienstleistungen bedienen.
Für einige Schlüsselsektoren der deutschen Industrie ergeben sich aber auch erhebliche Risiken. Überdeckt von der Schuldenkrise der 1990er-Jahre, hat in der japanischen Fahrzeug-, Elektro- und Elektronikindustrie eine tiefgreifende Restrukturierung stattgefunden. Galten etwa Nissan, Toshiba oder Hitachi noch vor wenigen Jahren als Sanierungsfälle, so erleben wir nun die Rückkehr der Giganten. Toyota dominiert die globale Autoindustrie nicht nur ökonomisch, sondern hat auch das Zukunftsthema Ökologie besetzt. Ähnliches deutet sich aktuell in der Umwelttechnologie sowie in der Finanzbranche an. Hier steht den deutschen Paradebranchen harter Wettbewerb auf den Weltmärkten bevor.
In China ist nach der Euphorie der vergangenen Jahre Ernüchterung eingekehrt. Trotz steigendem GDP ist die Ertragslage der ausländischen Unternehmen, die in China investiert haben, überwiegend schlecht. GDP- und Gewinnwachstum sind nicht dasselbe. Auch wenn es mehr zu verteilen gibt, wird der unternehmerische Ertrag durch Umsatz und Kosten bestimmt. Die Umsätze aber sind gerade bei vielen Mittelständlern geringer, die Kosten höher als erwartet. Hinzu kommen die schwierigen Rahmenbedingungen, insbesondere Produktpiraterie und Technologieklau. Die Ursachen dafür sind vielfältig und hängen wesentlich von der Art und Tiefe der in China erbrachten Wertschöpfung ab.
Wie soll es weitergehen? In den ertragsseitig kritischen Fällen – und das heißt: bei der Mehrheit der in China investierenden Firmen – zeichnen sich drei Reaktionsmuster ab.
Das Geschäft wird aus Marketinggründen (“wir müssen einfach in China vertreten sein”) in möglichst schlanker Form beibehalten.
Das Geschäft wird restrukturiert, der Fokus auf diejenigen Teile der Wertschöpfung gerichtet, die unter Markt- oder Ressourcengesichtspunkten besonders attraktiv sind.
Das Geschäft wird verkauft, China als Exportmarkt bedient.
Insgesamt ist in den kommenden Jahren eine rege Umbautätigkeit abzusehen. Das “Endgame” unter den ausländischen Unternehmen in China hat gerade erst begonnen.
Dr. Stefan Lippert, Tokyo