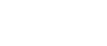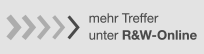Zur Unabhängigkeit von Notenbanken
Oder: über sachfremde und nicht sachfremde Einflüsse des Politischen
In der Liste der politischen und rechtlichen Übergriffigkeiten von US-Präsident Donald J. Trump nimmt der Streit mit dem Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, einen besonderen Stellenwert ein. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trump von Powell die Senkung der Leitzinsen verlangt. Er setzte Powell massiv unter Druck, drohte mit der Abberufung des obersten amerikanischen Währungshüters und schreckte auch nicht davor zurück, Powell persönlich zu beleidigen. Ende August fand dieser Streit seinen vorläufigen Höhepunkt. Der Präsident entließ Lisa Cook, ihres Zeichens Mitglied des Fed-Vorstands, mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt. Mittlerweile sind die Leitzinsen gesenkt, aber aus Sicht der US-Regierung nicht weit genug. Und der Fall Cook liegt jetzt bei Gericht. Der Streit wird also fortgesetzt.
I. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve
Der Vorgang wird allgemein als Kampfansage des US-Präsidenten an die Unabhängigkeit der Notenbanken eingeordnet. Das Federal Reserve Board gehört zu jenen überparteilichen, mit Experten besetzten Verwaltungsorganen, die fachliche Aufgaben in Unabhängigkeit von der Kontrolle durch den Präsidenten wahrnehmen”1. In der grundlegenden Entscheidung Humphrey's Executor2 aus dem Jahr 1935 hat der US Supreme Court dem Kongress die Befugnis zuerkannt, solchen Einrichtungen Verwaltungsaufgaben zur Wahrnehmung unabhängig von der Kontrolle der Exekutive zu übertragen.3 “Unabhängig” bedeute, dass solche Verfahren von dem entferntesten Einfluss, direkt oder indirekt, von jeder der beiden “anderen Gewalten frei” sein müssten.4 Das hat auch Folgen für die Möglichkeit des Präsidenten, Mitglieder solcher unabhängiger Einrichtungen zu entlassen: “Wenn der Kongress die Ernennung von Beamten vorsieht, deren Aufgaben von eher legislativer und judikativer als exekutiver Natur sind, und die Gründe für ihre Amtsenthebung einschränkt,
Diese seit Jahrzehnten festgefügten Grundätze scheinen nun ins Wanken zu geraten. Im Fall Trump v Wilcox hatte der Präsident Mitgliedern des National Labor Relations Board (NLRB) und des Merit Systems Protection Board (MSPB) – beides nach bisheriger Lesart unabhängige Verwaltungseinrichtungen – ohne Angabe von Gründen gekündigt. Obwohl Trump sich damit eigenmächtig über die Grundsätze von Humphrey’s Executor hinweggesetzt hatte, gab der Supreme Court einem Eilantrag von Trump auf Gewährung eines Aufschubs statt.
Von US-amerikanischen Verfassungsjuristen wurde dies als ein erstes Anzeichen für eine Abkehr des Supreme Court von den Grundsätzen der Humphrey's-Rechtsprechung gedeutet.6 Zwar hatte sich der Supreme Court – immerhin – zu der Klarstellung veranlasst gesehen, damit werde die Unabhängigkeit der Federal Reserve nicht angetastet. Die Begründung aber gibt mehr Rätsel auf, als dass sie Klarheit schafft. So soll es sich bei der Federal Reserve um einen Sonderfall handeln, eine “uniqely structured, quasi-private entitiy that follows in the distinct historical tradition of the First and Second banks of the United States”.7 Das ändert aber nichts daran, dass ein bisher eherner Grundsatz der amerikanischen Verfassung auf einen Ausnahmefall reduziert wird. Ausnahmefälle müssen eng ausgelegt werden, ihre Analogiefähigkeit ist geringer als bei Rechtsinstituten, die den verfassungsrechtlichen Regelfall betreffen. Es wundert deshalb nicht, dass sich die Richter Kagan, Sotomayor und Jackson zu einem Sondervotum veranlasst sahen. Darin kritisieren sie, dass sich die Senatsmehrheit von den Grundsätzen der Humphrey’s Executor- Rechtsprechung entfernt habe.
II. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank
Auch die für Deutschland zuständige Notenbank, die EZB, ist unabhängig. Geben die Geschehnisse in den USA Anlass, ihre Unabhängigkeit stärker zu schützen? Ähnlich wie dies für das BVerfG mit der Änderung der Art. 93 und 94 GG8 erfolgt ist?
Hier bestehen doch entscheidende Unterschiede:
-
Die Art. 93 und 94 GG wurden vor allem geändert, weil wesentliche Strukturprinzipien bisher nur einfachgesetzlich verankert waren und auf die verfassungsrechtliche Ebene hochgezont werden mussten. Die Unabhängigkeit der EZB ist hingegen in der ersten Reihe sogar doppelt abgestützt: im Verfassungsrecht (Art. 88 S. 2 GG) und im Europäischen Primärrecht (Art. 130, 131 AEUV). Zudem ist die Regelungsdichte größer und lässt weniger Spielräume für Übergriffe in den Kompetenzbereich der EZB.
-
Die Unabhängigkeit einer Verwaltungseinrichtung führt zur Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus der Entscheidung. Das unterscheidet sie von der richterlichen Unabhängigkeit und begrenzt Reichweite und Intensität des Schutzes der Unabhängigkeit, die der Exekutive zugebilligt werden sollte.
Im Einzelnen:
1. Verankerung der Unabhängigkeit der Notenbank auf Verfassungsebene und im Europäischen Primärrecht
Deutschland hat seine Aufgaben und Befugnisse zum Betreiben einer Währungs- und Notenbank am 1. 1. 1999 auf die EZB übertragen. Seither fungiert die EZB als Währungs- und Notenbank des Bundes i.S. v. Art. 88 S. 1 GG. Die bisherige Bundesbank besteht als Institution zwar fort, hat aber ihre bisherigen geldpolitischen Entscheidungsbefugnisse an die EZB verloren und ist als nationale Zentralbank mit der Ausführung der Leitlinien und Weisungen der EZB-Organe betraut.9 Dies hat zur Folge, dass die Unabhängigkeit der EZB als der für Deutschland zuständigen Notenbank sowohl im Verfassungsrecht als auch im Europäischen Primärrecht verankert ist. Art. 88 S. 2 GG ist dabei nicht nur Ermächtigungsgrundlage für den Beitritt zum EZB-System, sondern fortdauernde Verpflichtung und Grundbedingung für den Fortbestand des Systems.
Insofern begründet Art. 88 GG auch nach dem Beitritt zur EZB ein “Zusammenspiel von nationalem Recht und Strukturprinzipien der Unionsverträge”10, bei dem Art. 88 S. 2 GG die Unabhängigkeit des EZB-Systems zur Bedingung sowohl für den Beitritt als auch den Fortbestand des ESZB macht.11 Er gibt die Unabhängigkeit der Notenbank als Grundbedingung für eine Übertragung der Staatsaufgabe der Notenbankpolitik auf die ESZB vor und hindert die Bundesregierung, an Änderungen des Unionsrechts mitzuwirken, die der Unabhängigkeit widersprechen. Umgekehrt hindern die Art. 130 und 131 AEUV die einfachgesetzliche Abschaffung der Unabhängigkeit der Notenbank durch den deutschen Gesetzgeber: Die unionsrechtliche Absicherung
Mit dem Unionsrecht wird eine weitere Normebene aktiviert, die im Rang nochmals über dem deutschen Verfassungsrecht steht und deren Änderung nochmals gesteigerten Mehrheitserfordernissen unterliegt. Das macht nachträgliche Änderungen schwieriger, da sie jeweils einer qualifizierten Mehrheit bedürfen: Art. 48 Abs. 5, Abs. 7 EUV; Art. 79 Abs. 2, Abs. 3 GG.
2. Gegenstand und Inhalt der Unabhängigkeit der EZB
Wesentlich detaillierter als im amerikanischen Recht sind die Normen des Unionsrechts über Gegenstand und Inhalt der Unabhängigkeit der EZB auf Primärrechtsebene gefasst.
a) Weisungsfreiheit
Art. 130 S. 1 AEUV verbietet es der ESZB, den nationalen Zentralbanken und den Mitgliedern ihrer Beschlussorgane, bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Unionsverträge oder die ESZB-Satzung übertragenen Kompetenzen Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einzuholen oder entgegenzunehmen.
Weisungen sind rechtlich verbindliche Ge- oder Verbote, die von einer vorgesetzten an eine nachgeordnete Stelle gerichtet werden.12
b) Beeinflussungsverbot
Art. 130 S. 2 AEUV enthält darüber hinaus ein Beeinflussungsverbot. Es ist zwar formal nur Teil der unionsrechtlich vorgeschriebenen Selbstverpflichtung durch die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten. Beides – Weisungsverbot und Beeinflussungsverbot – sind aber eng aufeinander bezogen und ergänzen sich. Ein Weisungsverbot, welches sich auf den Ausschluss formaler Weisungen beschränkte, wäre unvollständig
Art. 130 S. 2 AEUV erinnert an die Grundsätze der Humphrey's Executor-Rechtsprechung des US Supreme Court, wonach die Verfahren frei von dem – direkten und indirekten – Einfluss des Staates bleiben müssen (dazu oben I. bei Fn. 4). Das Beeinflussungsverbot umfasst alle faktischen und/oder mittelbaren Eingriffe in die Unabhängigkeit der EZB als Notenbank. Insoweit bietet es sich an, das von der Abgrenzung zwischen finalem und mittelbar-faktischem Grundrechtseingriff bekannte Kriterium der Funktionsäquivalenz heranzuziehen. Indirekte Weisungen, die die EZB nicht durch förmliches Gebot
Sehr weitgehend erscheint es allerdings, wenn jegliche auch noch so geringe Form der Beeinflussung verboten wäre. In diesem Sinne hat jedoch der EuGH den Begriff der völlig unabhängigen Behörde des europäischen Datenschutzrechts konkretisiert. Danach bezeichnet der Begriff “Unabhängigkeit” in der Regel eine Stellung, in der gewährleistet ist, dass die betreffende Stelle völlig frei von Weisungen und Druck handeln kann.14 Hierdurch verlöre das Verbot der indirekten Weisung jegliche begriffliche Kontur. Auch überzeugt nicht, weshalb eine rechtsaufsichtliche Kontrolle der Notenbank die Unabhängigkeit nachteilig beeinflussen soll. Der EuGH begründet dies damit, es lasse sich nicht ausschließen, dass die Aufsichtsstellen, die der Regierung des jeweiligen Landes unterstellt sind, nicht zu objektivem Vorgehen in der Lage sind.15 Die Regierung des betroffenen Landes hatte nämlich “möglicherweise ein Interesse an der Nichteinhaltung dieser Vorschriften”.16 Der EuGH lässt insoweit also die abstrakte Möglichkeit einer solchen Entwicklung genügen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Entwicklung wahrscheinlich ist oder zumindest real droht, werden nicht gefordert. Solche völlig abstrakten Gefahren aber lassen sich niemals ausschließen. Sachverhalte, die den Bereich der EZB berühren, ohne als Beeinflussung ausgelegt zu werden, sind kaum vorstellbar. Namentlich erscheint es kaum möglich, zwischen einer unzulässigen Beeinflussung und einer Meinungsäußerung abzugrenzen.17
c) Persönliche Unabhängigkeit der EZB-Mitglieder
Die Regeln zum Schutz der persönlichen Unabhängigkeit muten an wie Fortschreibungen und Modernisierungen der Humphrey's Executor-Kriterien. Sie sind im AEUV und in der EZB-Satzung geregelt. Hierzu gehören
– das Verbot der Wiederernennung (Art. 283 Abs. 2 Abs. 3 AEUV).
Es verhindert, dass ein Mitglied des Beschlussorgans aufgrund seines Interesses an einer Wiederwahl sich entsprechend den Erwartungen anderer Institutionen verhält.
– die Beschränkung der vorzeitigen Abberufung auf solche Fälle, in denen die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt werden oder eine schwere Verfehlung begangen worden ist (Art. 11.4 der ESZB-Satzung).
Diese Vorschrift bestimmt auch, dass die Amtsenthebung auf Antrag des ESZB-Rates und nur durch den Gerichtshof der Europäischen Union erfolgen
3. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank als Durchbrechung des Demokratieprinzips
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verlangt das Demokratiegebot grundsätzlich, dass jeder Amtsträger im Auftrag und nach Weisung der Regierung handelt, so dass die Regierung in die Lage versetzt ist, die Sachverantwortung gegenüber Volk und Parlament zu übernehmen.18 Die Weisungsgewalt der Regierung stellt insofern das Handeln der Exekutive “im Geist der Volksvertretung” sicher.19 Diese Verantwortung ist eine “sanktionierte demokratische Verantwortlichkeit”, die insbesondere auch die Kontrolle über die Art der Wahrnehmung der eingeräumten Aufgaben notwendig beinhaltet.20
Weisungsfreie Räume sind danach nur als seltene Ausnahme zulässig. Anerkannt ist dies neben den Fällen der funktionalen Selbstverwaltung21 bei Aufgaben von geringer politischer Tragweite22 oder bei Vorliegen unabweisbarer verfassungsrechtlicher Gegengründe.23 In Betracht kommt zudem eine Substitution der sachlich-inhaltlichen Legitimation kraft Weisungsrechts der Regierung durch eine strikte inhaltliche Gesetzesbindung, durch die im Ergebnis das geforderte effektive Legitimationsniveau sichergestellt werden kann.24
Für die EZB hat das BVerfG eine solche Ausnahme anerkannt, weil die Unabhängigkeit der EZB in Art. 88 S. 2 GG verbürgt ist. Sie sei mit demokratischen Grundsätzen noch vereinbar, weil sie der erprobten und wissenschaftlich belegten Besonderheit der Währungspolitik Rechnung trage, dass eine unabhängige Zentralbank den Geldwert und damit die allgemeine ökonomische Grundlage für die staatliche Haushaltspolitik eher sichert als Hoheitsorgane, die in ihrem Handeln von Geldmenge und Geldwert abhängen und auf die kurzfristige Zustimmung politischer Kräfte angewiesen sind.
Wegen der mit der Unabhängigkeit der EZB und der nationalen Zentralbanken (Art. 130, Art. 282 Abs. 3 S. 3 und S. 4 AEUV, Art. 88 S. 2 GG) verbundenen Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus muss diese Ausnahme aber eng begrenzt sein. Sie ist auf den Bereich einer vorrangig stabilitätsorientierten Geldpolitik beschränkt und lässt sich auf andere Politikbereiche nicht übertragen.25 Die gewährleistete Unabhängigkeit bezieht sich nur auf die der EZB durch die Verträge eingeräumten Befugnisse und deren inhaltliche Ausgestaltung, nicht aber auf die Bestimmung von Umfang und Reichweite ihres Mandats.
Damit die EZB nicht entgegen dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung in gültiger Weise ein Programm beschließen und durchführen kann, das über den Bereich hinausgeht, der der Währungspolitik durch das Primärrecht zugewiesen wird, muss die Beachtung der Grenzen der Zuständigkeit der EZB in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle unterliegen.26
Mit dieser verfassungsrechtlich gebotenen restriktiven Auslegung ist eine Interpretation der währungspolitischen Einzelermächtigungen unvereinbar, die die Angabe eines geldpolitischen Ziels beim Einsatz von Anleihekäufen ausreichen lässt und die wirtschafts- und fiskalpolitischen Wirkungen des PSPP sowohl für die Abgrenzung der Kompetenztitel als auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung für unmaßgeblich erklärt, selbst wenn diese Wirkungen vorhersehbar sind, bewusst in Kauf genommen oder möglicherweise sogar (stillschweigend) angestrebt werden.27
Der EuGH ist demgegenüber großzügiger in Bezug auf die Vereinbarkeit weisungsfreier Räume mit dem Demokratiegebot i.S. v. Art. 10 EUV. Er hält dies schon für berechtigt, weil mit einer Weisungsbefugnis der Regierung die “Gefahr einer politischen Einflussnahme”28 verbunden sei, welche die Behörde an der unparteilichen und objektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben hindere.29
Das offenbart ein Verständnis über die Rolle und Funktion des Politischen in einer Demokratie, die wenig nachvollziehbar ist. Wesenselement der Demokratie ist es gerade, dass das Volk als Träger und Inhaber der Staatsgewalt über die Volksvertretung politischen Einfluss und Kontrolle über die Regierung ausübt. Man denke nur an das Fragerecht der Abgeordneten.
Es zeigt sich also: Politischer Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt ist nicht per se sachfremd, sondern im Gegenteil durch das demokratische Prinzip geradezu gefordert. Das BVerwG bringt es auf den Punkt: “In der parlamentarischen Demokratie des Grundgesetzes lässt sich die Aufhebung der parlamentarischen Verantwortung und die Weisungsfreiheit der Regierung nicht mit Gefahren rechtfertigen, die der Währung durch demokratisch legitimierte Organe erwachsen können. Denn solche Gefahren wären im Wesen der Demokratie begründet und könnten nur durch ein ausgewogenes System gegenseitiger Kontrolle, Hemmung und Mäßigung der drei Gewalten behoben werden.”30 Es kann deshalb nur darum gehen, die Verwaltung zu schützen, wenn die Gefahr droht, dass über Weisungen ein politischer Einfluss ausgeübt werde, der sachfremd ist und die Verwaltung von der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben abhält. Dafür braucht es Anhaltspunkte. Das Politische als solches ist kein solcher Anhaltspunkt, es ist nicht per se sachfremd.
Nicht unterschätzen darf man auch die Gefahren, die mit der Anerkennung einer völlig unabhängigen Behörde verbunden sind. Insofern sollte man die derzeitigen Frontlinien nicht verabsolutieren, bei denen die Gefahren für das Gemeinwohl von der US-Regierung ausgehen. Aber auch mit der völlig unabhängigen Behörde wird anstelle der Herrschaft des gewählten Parlaments und der von ihm bestellten Regierung die “Herrschaft von Sachverständigen” etabliert.31 Auch die unabhängige, aus sachverständigen Experten zusammengesetzte Verwaltung ist aber weder “apolitisch” noch “vor sachfremden Einflüssen geschützt”. Sie besteht aus Menschen, die Herrschaft und damit Macht über andere ausüben; es liegt in der Natur der Sache, dass hierbei auch Fachbehörden – namentlich dort, wo ihnen politisch-planerische Gestaltungsspielräume bewusst eingeräumt sind – eigene (Macht-)Interessen verfolgen können (und in der Regel auch werden) und dass diese Interessen schon deshalb auch sachfremd, weil nicht objektiv sein können.32 Werden der Einfluss des Politischen und objektive Verwaltung in einen Gegensatz gebracht, wird die Exekutive also in Wahrheit nicht entpolitisiert, wohl aber entdemokratisiert. Und sie ist nicht mehr kontrolliert, weil ihre Unabhängigkeit ja gerade jeglicher sachlicher Einflussnahme auf ihre Tätigkeit entgegenstehen soll.
III. Schluss
Der Streit zwischen Trump und der Federal Reserve fällt in eine Zeit, in der das amerikanische Verfassungsrecht vor einem tiefgreifenden Umbruch zu stehen scheint. Dies betrifft auch die für das amerikanische System typischen unabhängigen Verwaltungseinrichtungen, zu denen auch die Federal Reserve zählt. Hier wird sich zeigen, wie weit die rechtsstaatlichen Garantien der US-amerikanischen Verfassung reichen und Schutz gewähren können vor den Übergriffen eines Präsidenten, der offenbar keinen Stein auf dem anderen lassen will.
Uns geben solche Fälle Anlass zur Selbstvergewisserung. Hierbei zeigt sich, dass die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank normativ hochrangig abgesichert ist und einen relativ hohen Bestimmtheitsgrad aufweist. Solche Normen lassen sich deutlich schwerer umgehen als die Grundsätze einer richterrechtlich fundierten Case Law-Rechtsprechung.
Die von Donald Trump provozierten Streitfälle geben aber keinen Anlass, die nach deutschem Verfassungsrecht bestehenden Einwände gegen unabhängige Verwaltungseinrichtungen aufzugeben. Diese Einwände setzen daran an, dass die Anerkennung weisungsfreier Räume in der Verwaltung zur Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus führt. Das zeigt sich daran, dass durch unabhängige und weisungsfreie Verwaltungseinrichtungen der Einfluss des Politischen auf die Verwaltung zurückgedrängt werden soll. In einer Demokratie aber sollte dies nur getan werden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Einfluss des Politischen im konkreten Fall sachwidrig ist. Das aber kann nicht per se für das Politische angenommen werden, sondern nur bei entsprechenden Anhaltspunkten im Einzelfall.
Beim aktuellen Streit um die Leitzinsen der Federal Reserve spricht vieles dafür, dass die Motive des Präsidenten sachfremd sind. Denn zu stark ist der Streit bereits durch persönliche Interessen überlagert. Aber hüten wir uns davor zu glauben, unabhängige Expertengremien wären per se sachlich und neutral und gleichsam die Lösung zum Schutz vor dem Rechtspopulismus. Notwendig sind checks und balances – auch für unabhängige Verwaltungseinrichtungen.
Thomas Mayen
| 1 | Kagan in: US Supreme Court, Trump v. Wilcox, dissenting vote, 605 U.S. S. 1 (20235). |
| 2 | US Supreme Court, Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935). |
| 3 | US Supreme Court, Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 629 (1935). |
| 4 | US Supreme Court, Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 630 (1935). |
| 5 | US Supreme Court, Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935). |
| 6 | Vgl. etwa Driesen, The Unitary Executive Theory in Comparative Context, 72 Hastings L.J. 1 (2020), abrufbar unter https://respository.uclawsf.edu/hatsings_ law_ journal/vol72/iss1/1; Sunstein und Vermeule in: The Unitary Executive: Past, Present, Future, 2020 Sup. Ct. Rev. 83 (2021). |
| 7 | US Supreme Court (Fn. 1), S. 2. |
| 8 | Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 93 und 94) vom 28. 12. 2024 (BGBl. I Nr. 439). |
| 9 | Bonner Kommentar zum GG/Häde, 32. Lfg. 8. 2025, Art. 88 Rdn. 625. |
| 10 | Dürig/Herzog/Scholz/Herdegen, GG, 107 Aufl. 2025, Art. 88 Rdn. 4. |
| 11 | Bonner Kommentar zum GG/Häde (Fn. 9), Art. 88 Rdn. 612. |
| 12 | Ähnlich Calliess/Ruffert/Häde, EUV – AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 130 AEUV Rdn. 14. |
| 13 | Nachweise hierzu bei Mayen, GS Sachs, 2024, S. 63, 68 ff. |
| 14 | EuGH v. 14. 10. 2008 – C-518/07 Rdn. 18. |
| 15 | EuGH v. 14. 10. 2008 – C-518/07 Rdn. 34. |
| 16 | EuGH v. 14. 10. 2008 – C-518/07, Rdn. 35. |
| 17 | Zur Unterscheidung vgl. aber Calliess/Ruffert/Häde (Fn. 12), Art. 130 AEUV Rdn. 15. |
| 18 | BVerfGE 44, 125, 139; 47, 253, 271 f.; 83, 60, 71 f.; 93, 37, 66 f.; 89, 155, 182; 107, 59, 87 f.; BVerwGE 106, 64, 75. |
| 19 | Isensee/Kirchhof/Böckenförde, HStR Bd. 2, 3. Aufl. 2004, § 24 Rdn. 21 (unter Berufung auf L. von Stein, Die Verwaltungslehre, Teil 1, 1. Halbbd., 2. Aufl. 1869, S. 345 ff.). |
| 20 | Isensee/Kirchhof/Böckenförde (Fn. 19), § 24 Rdn. 21. |
| 21 | Vgl. dazu BVerfGE 107, 59, 87 ff. |
| 22 | Vgl. dazu BVerfGE 9, 268, 282; 83, 139, 150. |
| 23 | Im Einzelnen dazu Mayen, DÖV 2004, 45, 47 ff. m.w. N. |
| 24 | Zur Möglichkeit der Substitution zwischen einzelnen Formen demokratischer Legitimation BVerfGE 93, 37, 67; 119, 331, 366; 107, 57, 86 ff. Vgl. ferner Maunz/Dürig/Grzeszick, GG, Bd. 3, 107. Aufl. 2025, Art. 20 Abs. 2 Rdn. 130. Speziell zum Komplementärverhältnis von Weisungsbindung und strikter Gesetzesbindung Isensee/Kirchhof/Böckenförde (Fn. 19), § 24 Rdn. 22. |
| 25 | BVerfGE 134, 366 Rdn. 59. |
| 26 | BVerfGE 89, 155, 207 ff., 211 f.; 134, 366, 399 f. Rdn. 59; 142, 123, 219 ff. Rdn. 187 ff.; 146, 216, 278 Rdn. 102 f.; BVerfG v. 30. 7. 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 Rdn. 134, 139, 211, 154, 17 Rdn. 143. |
| 27 | BVerfGE 154, 17 Rdn. 143. |
| 28 | EuGH, Rs. C-518/07 (Kommission/Deutschland), Slg. 2010 I-01885, Rdn. 36. |
| 29 | EuGH, Rs. C-518/07 (Kommission/Deutschland), Slg. 2010 I-01885, Rdn. 34: “Es lässt sich aber nicht ausschließen, dass die Aufsichtsstellen, die Teil der allgemeinen Staatsverwaltung und damit der Regierung des jeweiligen Landes unterstellt sind, nicht zu objektivem Vorgehen in der Lage sind, wenn sie die Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten auslegen und anwenden.” |
| 30 | BVerwGE 41, 334, 355. |
| 31 | Zutreffend Bull, EuZW 2010, 488, 492. Kritisch gegenüber den Gefahren des Ziels einer (vermeintlichen) Entpolitisierung auch Lepsius in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, 2010, § 19 Rdn. 70, sowie Bach in: Schuppert/Pernice/Haltern, Europawissenschaft, 2005, S. 575, 604 f. |
| 32 | Petri/Tinnefeld, MMR 2010, 355, 356. |