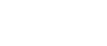Dr. Björn Steinrötter: Graduelle Ausweitung des internationalen Verbrauchergerichtsstands durch den EuGH und der Eindruck der Methodenunehrlichkeit
Er hat es wieder getan. Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) bereits mehrfach die Gelegenheit hatte, die textgleiche Vorläuferregelung des Art. 17 Abs. 1 lit. c EuGVVO (Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO a.F.) auszulegen, bleibt er auch in der jüngsten Entscheidung (Urteil vom 12.12.2015 – Rs. C-297/14, Hobohm; vorgelegt hatte der BGH, 15.5.2015 – III ZR 255/12; beachte auch die Schlussanträge des GA Cruz Villalón vom 8.9.2015) seiner Linie treu, den Schutzgerichtsstand für Verbraucher extensiv zu deuten. Als „Wiederholungstäter“ erweist sich der Gerichtshof auch hinsichtlich eines weiteren Gesichtspunkts.
Die methodische Fundierung der Entscheidung stößt in Teilen einmal mehr auf Kritik im Schrifttum (Mankowski, NJW 2016, 699, 700; R. Wagner, EuZW 2016, 269, 270; vgl. bereits v. Hein, LMK 2014, 360325), weshalb vornehmlich jene den Gegenstand dieses Standpunktes bilden soll (eingehend zum Urteil, zur Bewertung der ratio decidendi und deren Reichweite Heinze/Steinrötter, IPRax 6/2016).
I. Gleichwohl kurz zur Systematik des Schutzgerichtsstandes: Der allein nach Maßgabe von Art. 19 abdingbare Art. 17 EuGVVO bestimmt, ob die internationale Zuständigkeit sich nach Art. 18 EuGVVO richtet. Sind die Voraussetzungen des Art. 17 demnach gegeben, kann der Verbraucher seine Klage gemäß Art. 18 Abs. 1 vor dem mitgliedstaatlichen Beklagtenwohnsitz sowie (seit der Neufassung des Sekundärrechtsaktes auch drittstaatlichen) eigenen Wohnsitz erheben. Dem Verbraucher steht insofern ein Wahlrecht zu. Klagt der Unternehmer, muss dieser sich gemäß Art. 18 Abs. 2 EuGVVO an das mitgliedstaatliche Forum des Verbrauchers halten. Dem Verbraucher soll damit in jedem Fall die Möglichkeit eines ortsnahen Gerichtsstandes zugewiesen werden.
Die – hier interessierende – Norm des Art. 17 Abs. 1 lit. c Var. 2 EuGVVO weist diverse, sorgfältig voneinander zu trennende Tatbestandselemente auf, welche namentlich nicht sämtlich im prominenten Merkmal des „Ausrichtens“ kulminieren. Bei zutreffender Lesart der Bestimmung finden sich sonach nachfolgende Voraussetzungen.
In persönlicher Hinsicht bedarf es zunächst – für alle Fälle des Art. 17 Abs. 1 EuGVVO – eines Vertrages zwischen einem Verbraucher (stets eine natürliche Person) und einem Unternehmer (dies ist anerkannt, obwohl die Norm diesen nicht ausdrücklich nennt), wobei die diesbezügliche Subsumtion „konkret handlungsbezogen“ zu erfolgen hat.
In sachlicher Hinsicht müssen ein Vertrag bzw. vertragliche Ansprüche den Gegenstand des Verfahrens bilden. Es kommt aus Schutzzweckgesichtspunkten nicht darauf an, ob das Rechtsgeschäft wirksam geschlossen wurde (so aber GA Cruz Villalón in seinen Schlussanträgen Rs. C-297/14, Hobohm, Rn. 27). Ist ein Kontrakt etwa deshalb nichtig, weil ein Geschäftsunfähiger hieran beteiligt war, bliebe kaum einsichtig, warum diesem der Schutzgerichtsstand verwehrt sein sollte. Unerheblich ist ferner der Ort des (vermeintlichen) Vertragsschlusses (Staudinger, in: Rauscher, EuZPR/EuIPR, 2011, Art. 17 Brüssel Ia-VO Rn. 13).
Abs. 1 lit. c stellt einen sehr weitgehenden Auffangtatbestand dar, der allein den Teilzahlungs- (lit. a) sowie den Finanzierungskauf (lit. b) nicht erfasst. Ganz allgemein grenzt zudem Art. 17 Abs. 3 EuGVVO Beförderungsverträge vom Anwendungsbereich der Schutzregel aus (beachte aber die Rückausnahme für Pauschalreiseverträge).
Innerhalb des – hier interessierenden – lit. c Var. 2 greifen nach dem EuGH (Urteil v. 6.9.2012 – Rs. C-190/11, Mühlleitner, Rn. 36) zwei Voraussetzungen Platz.
Zunächst muss der Unternehmer seine Tätigkeit (zumindest auch) auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausrichten. Ziel dieser recht weit gefassten Formulierung war es insbesondere, der wachsenden Bedeutung des elektronischen Geschäftsverkehrs Rechnung zu tragen (KOM[1999] 348 endg., S. 7, 17 f.; vgl. auch KOM [2005], 650 endg., S. 6 f.; siehe die Konturierung des „Ausrichtens“ insbesondere im Zusammenhang mit Online-Geschäften in den Urteilen EuGH, 7.12.2010 – verb. Rs. C-585/08 und C-144/09, Pammer; EuGH, 6.9.2012 – Rs. C-190/11, Mühlleitner; EuGH, 17.10.2013 – Rs. C-218/12, Emrek).
Als zweite Prämisse des lit. c muss der in Rede stehende Vertrag in den Bereich eben dieser „ausgerichteten“ Tätigkeit fallen.
II. Diesem zuletzt genannten Kriterium hatte sich der EuGH nunmehr in der Rs. Hobohm zu widmen. Der Entscheidung (die noch zu Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO a.F. erging, aber auf Art. 17 Abs. 1 lit. c EuGVVO übertragbar ist) lag ein Sachverhalt zugrunde, in der Verträge verschiedenen Inhalts, jedoch mit einer gewissen Verbindung zueinander vorlagen, welche die Parteien zu unterschiedlichen Zeiten abschlossen. Die erste Abrede (Vermittlung des Kaufoptionsvertrages hinsichtlich einer Immobilie) unterfiel dabei der ausgerichteten Tätigkeit des Unternehmers, eines Maklers, und damit dem Schutzgerichtsstand. Das zweite – streitgegenständliche – Rechtsgeschäft (Geschäftsbesorgungsvertrag, der die Durchführung des Kaufvertrages gewährleisten sollte, nachdem der Bauträger in finanzielle Schwierigkeiten geriet), bildete hingegen – für sich betrachtet – nicht die ausgerichtete Tätigkeit des Maklers ab.
Der EuGH betonte nun zunächst das aus der Abweichung vom actor sequitur-Grundsatz (Art. 4 Abs. 1 EuGVVO) folgende Gebot der engen Auslegung des Schutzgerichtsstandes (EuGH Rs. C-297/14, Hobohm, Rn. 30 ff., 39). Recht knapp bejahte er sodann gleichwohl die Anwendung des Art. 15 Abs. 1 lit. c Var. 2 EuGVVO a.F. auf den zweiten Vertrag und begründete dies mit der „engen Verbindung“ zum ersten. Denn der wirtschaftliche Erfolg des Maklervertrages sollte durch die Geschäftsbesorgung in „unmittelbarer Fortsetzung“ der Maklertätigkeit erreicht werden (Rn. 34 f.).
Der Gerichtshof nennt in der Folge diverse Indizien, welche eine derartige „enge Verbindung“ (kritisch wegen der Unbestimmtheit dieses Begriffs R. Wagner, EuZW 2016, 269, 270) zwischen zwei Verträgen in einer Gesamtabwägung des nationalen Gerichts zu rechtfertigen vermögen: „insbesondere die rechtliche oder tatsächliche Identität der Parteien […], die Identität des wirtschaftlichen Erfolgs, der mit den Verträgen angestrebt wird, die denselben konkreten Gegenstand betreffen, und den ergänzenden Charakter des Geschäftsbesorgungsvertrags im Verhältnis zu dem Maklervertrag“ (Rn. 37).
III. Es ging in der Rs. Hobohm somit mitnichten um die Auslegung des „Ausrichtens“ (in diesem Sinne aber wohl die Interpretation der Vorlageentscheidung des BGH durch v. Hein, LMK 2014, 360325, wonach der BGH zögerte, eine Ausrichtung „im Hinblick auf den Geschäftsbesorgungsvertrag“ anzunehmen). Denn ein solches war mit Blick auf den Maklerkontrakt zweifellos gegeben (was dem EuGH zur „Aktivierung“ dieses Tatbestandsmerkmals ausreichte), während es bezüglich des Geschäftsbesorgungsvertrages – zumindest bei dessen isolierter Betrachtung – nicht vorlag. Mit anderen Worten: Die auf Deutschland ausgerichtete Tätigkeit erfasste den Inhalt des Geschäftsbesorgungsvertrages als solchen nicht.
Angesprochen war vorliegend vielmehr das Erfordernis in Abs. 1 lit. c a.E.: „(…) und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.“ Der Verbraucherschutz, vor allem aber auch die Prozessökonomie und das Bestreben, Parallelverfahren zu vermeiden, dürften es gebieten, dieses Tatbestandsmerkmal tendenziell weit auszulegen. So kann es nach dem EuGH bei inhaltlich und wirtschaftlich eng verbundenen Verträgen nunmehr also zu einer „verbraucherschützenden Infizierung“ (vgl. Mankowski, NJW 2016, 699) desjenigen Kontrakts kommen, der für sich allein genommen nicht unter die konkrete ausgerichtete Tätigkeit des Unternehmers fällt, der aber gleichwohl – semantisch weiter zu fassen – dem „Bereich“ dieser Tätigkeit noch zuzuschlagen ist. Hier erfüllte folglich der Maklervertrag das „Ausrichten“, der Geschäftsbesorgungsvertrag fiel in den Tätigkeitsbereich – was dann additiv reichte.
Beinahe ironisch mutet es an, wenn der EuGH die restriktive Handhabung des Verbraucherschutzgerichtsstandes als Ausnahmevorschrift erneut postuliert, in der Sache indes eine immer weitere Auslegung praktiziert. Einmal mehr wirkt das Vorgehen des Gerichtshofs zumindest aus der Perspektive von im hiesigen Rechtskreis sozialisierten Juristen als vornehmlich ergebnisorientiert (in diesem Sinne auch R. Wagner, EuZW 2016, 269, 270; vgl. auch W.-H. Roth, GPR 2016, 77 und Baldus/Raff, Unionsrechtliche Überformung mitgliedstaatlicher Methodik, GPR 2016, 71). Der vom EuGH stets behauptete Ausnahmecharakter der Verbraucherschutzvorschriften besteht allenfalls noch auf dem Papier seiner Urteile. De facto hat sich das Regel-Ausnahmeverhältnis längst umgekehrt.
Es handelt sich hierbei keineswegs um eine zu vernachlässigende Diskrepanz zwischen der Dialektik des Gerichtshofs und seinen Ergebnissen. Vielmehr haben diese „Lippenbekenntnisse“ (vgl. Kieninger, Grenzenloser Verbraucherschutz, in: Mankowski/Wurmnest (Hrsg.), Festschrift für Ulrich Magnus zum 70. Geburtstag, 2014, S. 449, 454) in praxi durchaus Auswirkungen. So dürfte der Umstand der permanenten Betonung der engen Auslegung des Verbrauchergerichtsstandes für die Entscheidung des BGH, es handele sich um eine vorlagepflichtige Rechtsfrage maßgeblich gewesen sein (BGH, III ZR 255/12, Rn. 19 f.; die Instanzgerichte – OLG Celle, 18.7.2012 – 7 U 213/11 und LG Stade, 21.9.2011 – 2 O 80/11 – hatten die Zuständigkeit verneint; wie hier die Deutung durch v. Hein, LMK 2014, 360325). Andernfalls hätte aufgrund der bisherigen EuGH-Judikatur eine acte clair-Situation nämlich durchaus nahegelegen (v. Hein, LMK 2014, 360325).
Schon in Emrek mochte man in der Begründung des EuGH methodische Defizite ausmachen. Hier hatte der EuGH das Erfordernis eines Kausalzusammenhangs zwischen Ausrichten qua unternehmerischer Website und Vertragsschluss verneint (EuGH Rs. C-218/12, Emrek, Rn. 32; kritisch dazu Staudinger/Steinrötter, NJW 2013, 3505). Nicht recht nachvollziehbar erschien hier, dass der Gerichtshof sich mit keinem Wort im Wege rechtsaktübergreifender Auslegung zu Erwägungsgrund 25 Satz 2 Rom I-VO äußerte. Dieser, auf das kollisionsrechtliche Gegenstück des Schutzgerichtsstandes abhebende Erwägungsgrund fordert, dass der Vertragsschluss auf das Ausrichten „zurückzuführen“ sein müsse. Das hätte man mit Blick auf die ein Konkordanzgebot zwischen kollisionsrechtlichen und internationalverfahrensrechtlichen Sekundärrechtsakten festschreibenden Erwägungsgründe 7, 24 Satz 2 durchaus auch auf die internationale Zuständigkeit übertragen können, jedenfalls aber diskutieren müssen. Ob spezifische prozessuale Interessen hier gegen eine harmonische Auslegung streiten, erscheint äußerst fraglich. Auch kommt dem historischen Argument, die Neufassung der EuGVVO habe kein Gegenstück zum Erwägungsgrund 25 Satz 2 Rom I-VO aufgenommen, mit Blick auf die zeitliche Abfolge (Revision der EuGVVO: 12.12.2012 – Urteil in der Rs. Emrek: 17.10.2013) kein entscheidendes Gewicht zu. Denn insofern könnte es noch am Problembewusstsein des Verordnungsgebers gefehlt haben.
Nun wäre es für den Gerichtshof keineswegs a priori methodisch unzulässig oder in der Sache anrüchig gewesen, sich über einen bloßen Erwägungsgrund hinwegzusetzen. Nicht nachvollziehbar erscheint jedoch die (zumindest scheinbare) Willkür, mit welcher der EuGH sich einmal – das Konkordanzgebot zwischen den internationalrechtlichen Sekundärrechtsakten im Ausgangspunkt beachtend – ausdrücklich mit rechtsaktübergreifender Systematik auseinandersetzt (so in den verb. Rs. C-585/08 und C-144/09, Pammer, Rn. 84, und Rs. C-190/11, Mühlleitner, Rn. 33 ff., mit Blick auf Erwägungsgrund 24 Satz 3 f. Rom I-VO), diese ein anderes Mal hingegen schlichtweg ausspart (zur möglichen Motivation des EuGH in derlei Fällen siehe Heinze/Steinrötter, IPRax 6/2016, unter V.). Das überrascht umso mehr, als der Erwägungsgrund 25 Satz 2 im Vergleich zu dem in den zuvor genannten Rechtssachen diskutierten Erwägungsgrund 24 Satz 3 f. nicht bloß in Zitatform Eingang in den Kollisionsrechtsakt gefunden hat. Somit wäre Erwägungsgrund 25 Satz 2 Rom I-VO sogar ein Stück weit autoritativer gewesen und hätte deshalb erst recht der Auseinandersetzung bedurft.
So verwundert es nach alledem kaum, dass die Methodenehrlichkeit des EuGH zuweilen in Frage gestellt wird (v. Hein, LMK 2014, 360325; zustimmend Mankowski, NJW 2016, 699, 700; vgl. allgemein auch R. Stürner, AcP 214 [2014], 7, 22 f.). Tatsächlich erscheinen die im Ausgangspunkt auch für das Europarecht geltenden (Riesenhuber, in: ders, Europäische Methodenlehre, 3. Auf. 2015, § 10 Rn. 12 ff.) klassischen Auslegungskanones abseits von Sinn und Zweck einer Norm (bzw. des Regelwerkes in toto) nicht selten als bloße Feigenblätter, um ein methodisches Vorgehen vorzugeben, welches realiter nicht vollzogen wird. Das verwirrt Gerichte bestimmter (kontinentaleuropäischer) Staaten mit Blick auf methodische Fragen (v. Hein, LMK 2014, 360325) und sendet widersprüchliche Signale (Mankowski, NJW 2016, 699, 700). Die unionsrechtliche Rechtsfindung geschieht freilich autonom, mithilfe einer eigenen Methodenlehre (siehe etwa Adrian, Grundprobleme einer juristischen [gemeinschaftsrechtlichen] Methodenlehre, 2009; Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, 1997; Henninger, Europäisches Privatrecht und Methode, 2009).
Es ist auch die Aufgabe der Rechtswissenschaft, diese weiter zu entwickeln und sodann auf deren Einhaltung zu pochen, ohne sich dabei in Formalismus zu verrennen und die jeweiligen eigenen mitgliedstaatlichen Usancen als allein heilsbringend anzusehen. Insbesondere dann, wenn man die „deutsche Brille“ aufsetzt und den hiesigen Stellenwert der Methodenlehre und der Feindogmatik betrachtet: Kein leichtes Unterfangen.
Dr. Björn Steinrötter, 2003–2005 Ausbildung zum Bankkaufmann. 2005–2010 Studium der Rechtswissenschaft und 2010–2013 wiss. Mitarbeiter (Prof. Dr. Ansgar Staudinger) an der Universität Bielefeld. 2013–2015 Referendariat in Berlin und Sydney mit Stationen u.a. beim Bundesministerium der Justiz (Referat für IPR) sowie bei international ausgerichteten Wirtschaftskanzleien. Seit Mai 2015 akademischer Rat a. Z. an der Leibniz Universität Hannover (Prof. Dr. Christian Heinze).