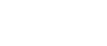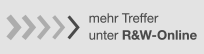Reinen Wein einschenken? Gefälschte Lebensmittel und Getränke in der EU

Dr. Stephan Schäfer
Das Europäische Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) machte zum Weltfälschungstag am 11.06.2025 auf eine gefährliche Entwicklung aufmerksam (vgl. EUIPO, PM vom gleichen Tag). Unter dem Slogan „Was kommt auf den Tisch?“ startete das EUIPO eine Verbraucher-Kampagne, um darauf hinzuweisen, dass Lebensmittel die am zweithäufigsten gefälschte Produktkategorie darstellen, die an den EU-Außengrenzen aus dem Verkehr gezogen werden.
Damit weist das EUIPO auf einen Aspekt von Lebensmittelbetrug („Food Fraud“) hin, der zwar seit langem bekannt ist, dessen Ausmaß aber schockierend ist. Mit beeindruckender krimineller Energie wird gefälscht und gepanscht. Vor allem Wein und Spirituosen sind betroffen. Hier werden etwa Originalflaschen mit minderwertigem Wein wiederbefüllt oder gefälschte Etiketten aufgedruckt. Aber auch schnelldrehende Artikel wie Kekse, Teigwaren und Süßigkeiten stehen im Fokus der Fälscher.
Der wirtschaftliche Schaden ist beträchtlich – europaweit gehen Unternehmen 2,29 Milliarden Euro Umsatz und 5.700 Arbeitsplätze verloren. Schlimmer wiegt noch, dass gefälschte Lebensmittel häufig gesundheitsgefährdende Substanzen wie Quecksilber oder Pestizide in unvertretbarem Ausmaß enthalten. Verbraucher sind hierfür bislang wenig sensibilisiert. Handelt es sich nicht gerade um eine Flasche seltenen Weins, sondern um ein relativ niedrigpreisiges Lebensmittel, ist die Neigung des Verbrauchers, dieses auf Fälschungen zu untersuchen, nicht gerade ausgeprägt. Perfide zudem: Ist das Lebensmittel konsumiert, sind die Spuren des Food Fraud meistens vernichtet.
Daher ist es zu begrüßen, dass die EUIPO das Augenmerk auf dieses Problem lenkt. Dabei setzt die Behörde vornehmlich in dem Bereich an, für den sie zuständig ist, nämlich dem europäischen System der geografischen Angaben, das zuletzt mit Wirkung zum 13.05.2024 mit der Verordnung (EU) 2024/1143 in ein neues Gewand gegossen wurde. Mit dieser Verordnung sollten die geografischen Angaben – in ihren unterschiedlichen Ausprägungen der geschützten Ursprungsbezeichnung (g. U.), der geschützten geografischen Angabe (g. g. A.) sowie der garantiert traditionellen Spezialität (g. t. S.) – aufgewertet und besser geschützt werden. Auch Nachhaltigkeitsaspekte und -verfahren sollen hierbei unter besonderen Schutz gestellt werden können (vgl. etwa Art. 4 VO (EU) 2024/1143). Das EUIPO hat zu Recht erkannt, dass das europäische System der geografischen Angaben allein nicht ausreicht, den Verbraucher angemessen vor den oben beschriebenen kriminellen Verhaltensweisen zu schützen. Es bedarf unterstützender Maßnahmen. In Alicante legt man auf Verbraucherseite den Fokus auf das Kennen und Erkennen von Produkt- und Herkunftskennzeichen sowie Zertifizierungslogos und die Prüfung der Verpackung auf typische Verarbeitungs- und Rechtschreibfehler. Unternehmen sollen verstärkt dazu befähigt werden, mit neuen Technologien (QR-Codes, Hologramme) die Fälschungssicherheit zu erhöhen.
Wer reinen Wein einschenken will, muss aber folgende Umstände zur Kenntnis nehmen: So löblich die Initiative des EUIPO ist, sie greift zu kurz. So nehmen Verbraucher Informationen auf oder im Zusammenhang mit Lebensmitteln nur eingeschränkt zur Kenntnis. Die im Zusammenhang mit den geografischen Angaben existierenden Siegel (g. U.; g. g. A. und g. t. S.) versprechen zwar einen Steuerungseffekt, um dem sog. „Information Overload“ durch optische Vereinfachung zu begegnen; sie sind aber – wie andere Marken auch – nicht generell fälschungsfest.
Auch kratzt das EUIPO mit seiner – notwendigerweise – auf Gewerbliche Schutzrechte bezogenen Betrachtung beim Thema Food Fraud eher an der Oberfläche. Denn Lebensmittelbetrug ist sehr vielschichtig, etwa im Bereich der Auslobung von Rohwarenherkünften oder bei Rezepturen.
Food Fraud droht aber auch aus ganz anderer Richtung – wobei die Verordnung (EU) 2024/1143 hierzu selbst einen sicher nicht so intendierten Anreiz setzt. Die Verordnung ist Teil des EU Green Deal und verfolgt eine Qualitäts- und Nachhaltigkeitspolitik, die den Übergang der europäischen Lebensmittelwirtschaft zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem ermöglichen soll (Erwägungsgrund 23 VO (EU) 2024/1143). Zusammen mit den weiteren nachhaltigkeitsbezogenen Vorgaben rund um CSDDD, CSRD, EUDR etc. schraubt der europäische Gesetzgeber damit die Qualitätsanforderungen für Lebensmittel in die Höhe; freilich um den Preis, dass manche Unternehmen ihre Produkte nicht mehr ohne Weiteres in den Verkehr bringen können.
Bestehen bereits jetzt Einfallstore für Food Fraud im System des Lebensmittelrechts, schlagen die Nachhaltigkeitsbegriffe mit daran geknüpften Verkehrsverboten echte Schneisen. Die Prognose lautet daher: Das Phänomen der Lebensmittelfälschungen wird durch die EUIPO-Kampagne nicht verschwinden, weil die Anreize zur Umgehung des komplexen EU-Lebensmittelsystems weiterhin bestehen. Kurzfristig den größten Nutzen dürfte es haben, wenn es dem EUIPO mit seiner Kampagne tatsächlich gelingt, Verbraucher dafür zu sensibilisieren, Lebensmittel nur bei vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen.
RA Dr. Stephan Schäfer, Berlin