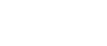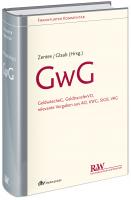EuG: EU-Taxonomie: Aufrechterhaltung der Einstufung von Atomkraft und fossilem Gas als nachhaltige Investitionen zur Unterstützung des Klimaschutzes durch das Gericht
EuG (Große Kammer), Urteil vom 10. 9. 2025 – Rs. T-625/22; Republik Österreich gegen Europäische Kommission
ECLI:EU:T:2025:869
PRESSEMITTEILUNG Nr. 113/25
Die Klage Österreichs gegen die Einbeziehung von Kernenergie und fossilem Gas in die Regelung für nachhaltige Investitionen wird abgewiesen
Die Kommission ist zutreffend davon ausgegangen, dass einige Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Kernenergie und von fossilem Gas unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen können
Im Jahr 2020 erließ der Unionsgesetzgeber (d. h. das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union) die Taxonomieverordnung,[1] mit der er einen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schuf. Diese Verordnung soll Finanzmittelflüsse hin zu nachhaltigen Tätigkeiten lenken, damit bis 2050 eine klimaneutrale Union erreicht wird.[2] Zu diesem Zweck enthält sie Kriterien dafür, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um so den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können.
Um als nachhaltig zu gelten, muss eine Wirtschaftstätigkeit nach der Taxonomieverordnung u. a. einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten, darf nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines dieser Ziele führen und muss bestimmten von der Europäischen Kommission festzulegenden technischen Bewertungskriterien entsprechen.
Damit hat der Unionsgesetzgeber der Kommission die Aufgabe übertragen, technische Bewertungskriterien festzulegen, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und ob sie eines der übrigen Umweltziele erheblich beeinträchtigt. Auf dieser Grundlage erließ die Kommission im Jahr 2021 eine Delegierte Verordnung zur Festlegung technischer Bewertungskriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Bereich erneuerbarer Energien.[3]
Im Jahr 2022 erließ die Kommission eine weitere Delegierte Verordnung,[4] mit der sie technische Bewertungskriterien für die Einbeziehung bestimmter Tätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossiles Gas in die Kategorien der Tätigkeiten festlegte, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leisten.
Österreich[5] hat beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Nichtigerklärung dieser Delegierten Verordnung erhoben.
Das Gericht weist die Klage Österreichs ab und bestätigt damit die Delegierte Verordnung der Kommission.
Das Gericht sieht in der Einbeziehung von Kernenergie und fossilem Gas in die Regelung für nachhaltige Investitionen durch die Kommission keine Überschreitung der ihr vom Unionsgesetzgeber wirksam übertragenen Befugnisse.
Insbesondere war die Kommission zu der Annahme berechtigt, dass die Erzeugung von Kernenergie nahezu keine Treibhausgasemissionen verursacht und dass derzeit keine technisch machbaren und wirtschaftlichen CO2-armen Alternativen wie erneuerbare Energiequellen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, um den Energiebedarf kontinuierlich und zuverlässig zu decken.
Die Kommission hat den beim normalen Betrieb von Kernkraftwerken auftretenden Risiken, den Risiken schwerer Reaktorunfälle und den Risiken im Zusammenhang mit hochradioaktiven Abfällen ausreichend Rechnung getragen.
Sie war insbesondere nicht verpflichtet, ein über den bestehenden Rechtsrahmen hinausgehendes Schutzniveau zu verlangen. Das Vorbringen Österreichs zu den negativen Auswirkungen von Dürren und klimatischen Unwägbarkeiten hat einen zu spekulativen Charakter, um durchzugreifen.
Überdies brauchte die Kommission, wie bei den übrigen Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Energieerzeugung, weder Tätigkeiten wie Uranabbau, -verarbeitung, -aufbereitung, -konversion und -anreicherung, Brennelementefertigung und Transport, bei denen es sich um vor- oder nachgelagerte Tätigkeiten handelt, noch die Auswirkungen bewaffneter Konflikte, Sabotage und die Gefahren des Missbrauchs und der Verbreitung ziviler und militärischer Anwendungen der Kernenergie zu berücksichtigen.
Schließlich billigt das Gericht den Ansatz, dass die Wirtschaftstätigkeiten im Bereich von fossilem Gas unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen können. Die Delegierte Verordnung von 2022 ist nämlich Teil eines schrittweisen Vorgehens, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen in Etappen zu verringern und zugleich die Versorgungssicherheit zu ermöglichen.
[1] Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 6. 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen.
[2] In der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 6. 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität („Europäisches Klimagesetz“) wird als verbindliches Ziel vorgegeben, für die Verwirklichung des im Übereinkommen von Paris festgelegten langfristigen Temperaturziels, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C zu halten und Anstrengungen zu seiner Begrenzung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu unternehmen, bis zum Jahr 2050 in der Union Klimaneutralität zu erreichen.
[3] Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. 6. 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese
[4] Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 9. 3. 2022 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten Energiesektoren und der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten.
[5] Vor dem Gericht wird Österreich durch Luxemburg unterstützt, während die Kommission durch Bulgarien, die Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, die Slowakei und Finnland unterstützt wird.